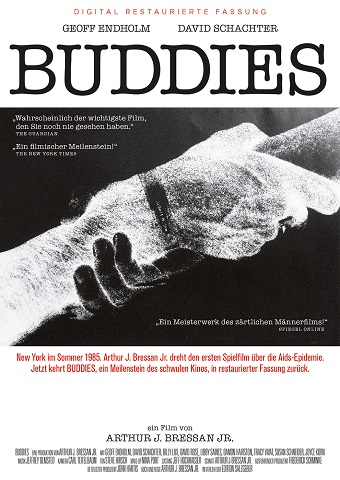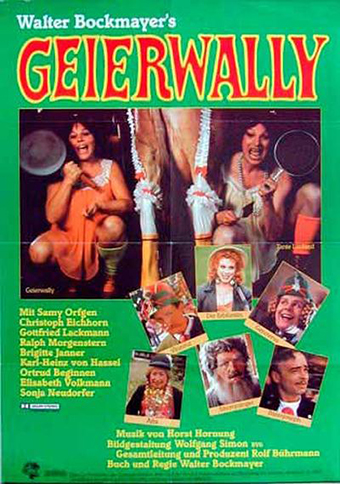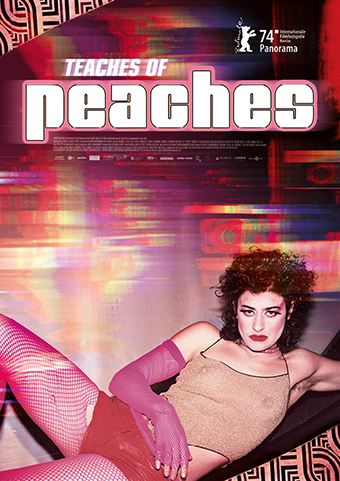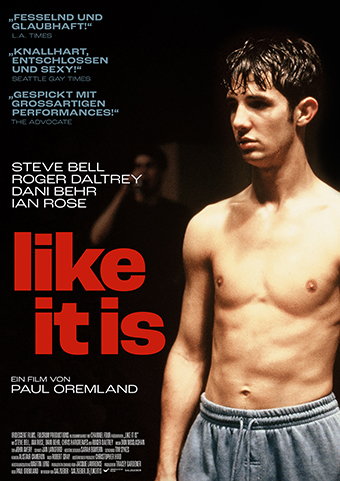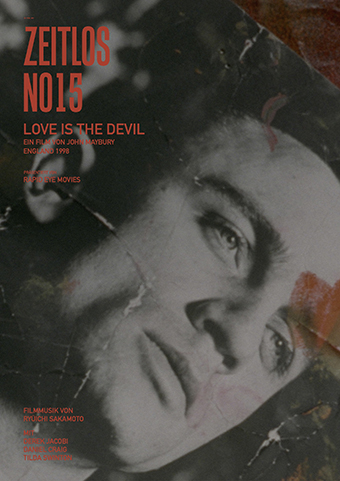Lose Your Head
Der Spanier Luis reist nach Berlin, um sich mit Partys, Drogen und schnellem Sex von der Trennung von seinem Ex abzulenken. Dort wird er mit dem griechischen Studenten Dimitri verwechselt, der seit Wochen verschwunden ist. Nach einer durchfeierten Nacht verknallt er sich in den mysteriösen Ukrainer Viktor, der irgendetwas mit Dimitris Verschwinden zu tun hat. Was wie ein ausgelassenes Abenteuer beginnt, entwickelt sich zu einer atemlosen Hetzjagd, bei der Luis droht, seinen Kopf zu verlieren. Patrick Schuckmann und Stefan Westerwelle nutzten in „Lose Your Head“ die Berliner Partyszene der 2010er Jahre als Hintergrund für einen intensiven Psychothriller, in dem die Grenzen zwischen Traum, Wirklichkeit und Paranoia immer mehr verschwimmen. Jetzt gibt es den Film im Salzgeber Club zu sehen. Jochen Werner über ein atmosphärisches Vexierspiel aus Nachtbildern und Clublichtern, in dem eine Figur beim Versuch die Stadt zu umarmen seine Souveränität als Individuum aufs Spiel setzt.