Maria by Callas
Trailer • Kino
Der Regisseur und Fotograf Tom Volf wirft einen neuen Blick auf Maria Callas. Über eine elegante Montage von privaten Aufnahmen, Mitschnitten ihrer Auftritte und TV-Interviews, aber auch gänzlich unbekanntem Material, wie etwa Nachrichtenaufnahmen von 1965, in denen glühende Fans ihrer Begeisterung freien Lauf lassen, spürt „Maria by Callas“ der unsterblichen Magie der Jahrhundert-Diva nach – und der Frage, wie sie zur universellen Identifikationsfigur für Außenseiter werden konnte. Ein Film über ein Leben im Wechselspiel von Verhüllung und Offenbarung, endlose Stunden des Schmerzes und eine alles verzehrende Liebe.

Foto: Prokino
„Io son l’amore“
von Sascha Westphal
Das Material fällt ein wenig aus dem Rahmen. Eigentlich konzentriert sich der Mode- und Reisephotograph Tom Volf in seinem Dokumentarfilm ganz auf Aufnahmen aus dem direkten Umfeld von Maria Callas, also auf private Super-8-Filme, Ausschnitte von ihren Opern- und Konzertauftritten und Mitschnitte von Fernsehinterviews. Doch versteckt inmitten dieser intimen Einblicke in die (Gedanken-)Welt der Callas finden sich auch Nachrichtenaufnahmen aus dem März 1965 in New York. 1958 hatte Rudolf Bing, der damalige Direktor der New Yorker Metropolitan Opera, den Vertrag mit Maria Callas aufgelöst. Knapp sieben Jahre später holte er sie für eine Aufführung von Puccinis „Tosca“ an die Met zurück. Eine kleine Sensation. Es gab Schlangen vor den Kassen, die weit über die Grenzen des Gebäudes hinausreichten. Nicht wenige campierten mehr als einen Tag vor der Oper. Davon zeugen die Bilder eines CBS-Reporters, der die Wartenden interviewt. In „Maria by Callas“ sieht man drei junge Männer, die voller schwärmerischem Enthusiasmus vom Genie der Sängerin sprechen und 30-minütige Standing Ovations ankündigen.
In diesem Moment weitet sich der Blick. Etwas blitzt auf, das Volf in seinem Film ansonsten ausblendet. Der Mythos Callas geht weit über die Oper und den Gesang, also die Kunst, hinaus. Ihre so präzise gespielten, meist mit wenigen kleinen, aber dafür umso ausdruckstärkeren Gesten auskommenden Auftritte waren Fluchtpunkte. In ihnen fand der Schmerz der Ausgegrenzten, der Misshandelten, der Unterdrückten, der sich selbst Verleugnenden, einen überwältigenden Ausdruck. Wenn Maria Callas damals als Tosca in London oder New York die Arie „Vissi d’arte“ („Ich lebte für die Kunst“) intonierte, schaffte dieses flehentliche Gebet an einen schweigenden, vielleicht sogar wegsehenden Gott eine Gemeinschaft. Sie richtete sich „in dieser Stunde des Schmerzes“, wie es bei Puccini heißt, immer auch an das Publikum und lud es ein, seinen Schmerz mit ihr zu teilen. Ein Augenblick der Transzendenz, nach dem sich die drei Interviewten und mit ihnen so viele andere Callas-Fans, einst und heute, geradezu verzehrten und immer noch verzehren.

Mit Luchino Visconti – Foto: Prokino
Diese kurzen Interviewschnipsel reichen aus, um die Bedeutung von Maria Callas’ Kunst zu umreißen. Sie sind wie die äußeren Wellenkreise, die ein Stein auslöst, den man in ein stilles Gewässer fallen lässt. Volf, der schon drei Bücher über die 1924 in New York geborene Sängerin herausgegeben und in Paris eine große Ausstellung kuratiert hat, widmet sich in seinem Found-Footage-Film– um im Bild zu bleiben – ansonsten eher dem Stein. „Maria by Callas“ gibt der „Tigerin“, wie sie sich selbst genannt hat, ihre Stimme zurück. Es ist ihr Film, so wie Pier Paolo Pasolinis „Medea“ ihr Film war. Dem Bild der schwierigen, zu stürmischen Ausbrüchen und tyrannischen Launen neigenden Diva stellt Maria Callas in ihren eigenen Worten das Selbstporträt einer Künstlerin und Frau entgegen, die sehr genau wusste, was sie wollte, und alleine dadurch provozierte. Volfs elegante Materialkompilation betont dabei die kämpferische Seite der Sängerin, die unerbittlich war, gegen alle, die ihren Vorstellungen von Kunst und Oper entgegenstanden, aber auch gegen sich selbst. Insofern liegt der Schwerpunkt des Films auf den Jahren von 1958 bis zu ihrem Tod 1977 in Paris.

Mit Pier Paolo Pasolini – Foto: Prokino / Mario Tursi
Am 2. Januar 1958 musste Maria Callas eine Vorstellung der „Norma“ in Rom aufgrund einer Bronchitis abbrechen. Der ungerechtfertigte und ungerechte Skandal, den sie damit auslöste, hat sie bis zu ihrem Lebensende begleitet. An diesem Abend, an dem der italienische Ministerpräsident im Publikum saß, ist etwas zerbrochen, auch in ihr, aber vor allem in ihrem Verhältnis zu den Medien. Aus privaten Briefen, die gelesen von Fanny Ardant (in der deutschen Fassung von Eva Mattes) ein zentraler Bestandteil des Films sind, erfährt man wie sehr die Angriffe sie verletzt haben. Fortan war eine gewisse Paranoia ihr ständiger Begleiter. Später rückte dann ihr Privatleben, vor allem ihre Beziehung zu Aristoteles Onassis, in den Fokus der medialen Öffentlichkeit. Bis zu einem gewissen Punkt überschatten diese gemachten Skandale alles andere.

Mit Aristoteles Onassis – Foto: Prokino
Maria Callas’ Interpretationen der großen Frauenrollen aus den Opern von Puccini und Verdi, Bellini und Cherubini, bekommen nach dem schicksalhaften Tag im Januar 1958 eine andere Bedeutung. Ihre Intonationen, die ab diesem Zeitpunkt nicht mehr die Leichtigkeit ausstrahlen, die sie in den ersten Jahren ihrer Opernkarriere prägte, werden zum Spiegel ihrer inneren und äußeren Kämpfe. Davon zeugen die aus dieser Zeit stammenden Tonaufnahmen klassischer Callas-Arien, die Volf ohne jegliche Kürzungen in sein Porträt integriert hat. So gleicht die von ihm ausgewählte Aufnahme von der aus Umberto Giordanos Oper „Andrea Chénier“ stammende Arie „La mamma morta“ einem Stich ins Herz. Wenn Maria Callas „Io son l’amore“ („Ich bin die Liebe“) singt, schwingen in diesem einen Satz alle Enttäuschungen eines Leben und zugleich eine unsterbliche Hoffnung mit. Auf den Flügeln dieses Gesangs lässt es sich entschweben.

Auf den ersten Blick nehmen die Liebe und Freundschaft, die Maria Callas mit Aristoteles Onassis verband, fast schon zu viel Raum in Volfs Dokumentarfilm ein. Die Briefe und die Bilder, die von ihnen erzählen, spiegeln zwar ausschließlich ihre Perspektive und rücken so einiges zurecht. Aber das Gefühl, dass die alten Klatschgeschichten endlich ruhen könnten, schwingt trotz allem mit. Doch dann eröffnen sich faszinierende Bezüge, wenn auf die Kommentare zur Hochzeit von Onassis mit Jackie Kennedy „Making of“-Aufnahmen von den Dreharbeiten zu Pasolinis „Medea“ folgen. Die Kunst der Callas ist untrennbar verbunden mit den Schlägen, die das Leben ihr versetzte. Sie erwächst aus Schmerz und verwandelt ihn. Zugleich offenbart sich in dieser von Volf angedeuteten Verknüpfung von Leben und Werk auch etwas von der Dualität, über die Maria Callas in einem Interview mit dem britischen Journalisten und Fernsehmoderator David Frost spricht.

Mit David Frost – Foto: Prokino
Ausschnitte aus diesem 1970 geführten Gespräch durchziehen den Film wie ein roter Faden, und gleich im ersten kurzen Schnipsel bekennt die Sängerin, dass es neben Maria auch noch die Callas gibt. Die Frau und die Künstlerin, der private Mensch und die öffentliche Persona, existieren zwar nebeneinander und sollten keineswegs miteinander verwechselt werden. Aber es gab, und daran lassen die von Volf zusammengetragenen bewegten Bilder nicht den geringsten Zweifel, einen fortwährenden Dialog zwischen beiden. Die eine schien in der anderen durch. Wer einmal eine Opernaufnahme mit ihr in der Hauptrolle gehört hat oder wer damals das Glück hatte, sie live auf der Bühne zu erleben, wusste von dieser Doppelexistenz. Ihre Kunst war ein Wechselspiel von Verhüllung und Offenbarung, und genau das verleiht ihr eine unsterbliche Magie, die „Maria by Callas“ auf wundervolle Weise einfängt.
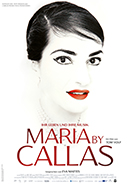
Maria by Callas
von Tom Volf
FR 2017, 113 Minuten, FSK: 0,
deutsche SF & OF mit deutschen UT,
Prokino
Ab 17. Mai hier im Kino.
