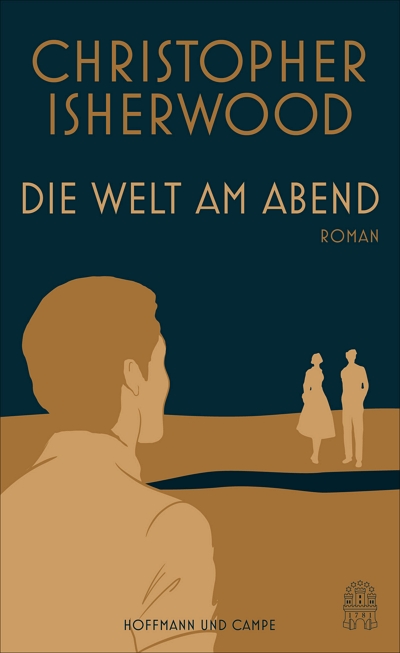Christopher Isherwood: Die Welt am Abend
Buch
Christopher Isherwoods literarisches Werk ist vielfältig: Neben den „Berlin Stories“ seiner Jugend gibt es Berichte über seine Annäherung an den Buddhismus und schließlich wieder autobiografisch gefärbte Texte über sein Leben als Hochschullehrer in den USA. Sein Roman „Die Welt am Abend“ aus dem Jahr 1954 ist stark von Introspektion geprägt, der Suche nach Liebe und dem eigenen Platz im Leben. Tilman Krause hat das Buch, das jetzt erstmals in deutscher Übersetzung vorliegt, für uns gelesen.
Der heiße Brei
von Tilman Krause
Also, ich muss schon sagen: Christopher Isherwood wird mir immer rätselhafter. Im letzten Jahr erschien im Rahmen der Werkausgabe bei Hoffmann und Campe sein früher, Anfang der Dreißigerjahre in Berlin entstandener Roman „Das Denkmal“, den ich für Sissymag rezensieren durfte. Schon da war ich überrascht, wie routiniert, ja raffiniert diese Schwulenikone von den Verwerfungen der englischen Gesellschaft nach dem „great war“ erzählte – in einer Sprache, die mit der coolen Sachlichkeit seiner „Berlin Stories“ nicht das Mindeste zu tun hat. Und nun bringt Hoffmann und Campe „Die Welt am Abend“ heraus.
Dieses Buch ist erzähltechnisch, aber auch mental noch weiter entfernt von jenen Texten, die Isherwood groß gemacht haben. In seiner Selbstzerfleischungssuada hat es aber auch nichts mit dem genüsslich im eigenen Können schwelgenden Roman „Das Denkmal“ zu tun. Es scheint mir ein Solitär zu sein im Schaffen des Schriftstellers. Aber sind nicht bei genauem Hinschauen alle seine Bücher Solitäre, die sich nicht wie bei anderen bedeutenden Autoren zu einem Gesamtpanorama fügen, sondern vor allem eines dokumentieren: ein ewiges Experimentieren?
Dass Isherwood nicht so weitermachte wie in der „Welt am Abend“, kann man natürlich damit erklären, dass das Buch bei Erscheinen 1954 floppte. Die Suche nach Liebe, ja überhaupt nach einer Perspektive im Leben, die seinen Protagonisten umtreibt und von England nach Deutschland, Frankreich, Spanien, Amerika sowie in die Arme von mehreren Frauen und einem Mann führen, mag zehn Jahre nach dem Krieg zu sehr an die Nöte der Zwischenkriegszeit erinnert haben. Es dürfte den Europäern außerdem zu amerikanisch, den Amerikanern zu europäisch vorgekommen sein. Immerhin ist es von Susan Sontag gelesen worden, die in ihrem Essay zur Camp-Ästhetik auf „Die Welt am Abend“ zurückkommt, wo tatsächlich (ziemlich nebenbei übrigens) diese angeblich typisch schwule Einstellung zu künstlerischen Dingen erörtert wird.
Was an „Die Welt am Abend“ aber vor allem irritiert, ist die Tatsache, dass die ganze Konstruktion irgendwie nicht stimmt. Dass der Ich-Erzähler um den heißen Brei herumredet. Der heiße Brei ist natürlich seine Homosexualität. Nun hat es ja auch in den prüden Vereinigten Staaten nach dem Krieg einen backlash gegeben, der den Diskurs über Gleichgeschlechtlichkeit erschwerte. Aber Isherwood spart das Schwule ja in „Die Welt am Abend“ keineswegs aus. Er lässt seinen Ich-Erzähler, den attraktiven, aber von Selbstzweifeln aller Art heimgesuchten – ja, was eigentlich? Schriftsteller? Publizisten? Lebemann? – Stephen Monk (also Mönch!) durchaus ein Liebesabenteuer mit einem jungen Mann erleben. Und er lässt ihn mit anderen Schwulen sogar darüber reden, dass der Kampf um die Rechte der Schwulen wichtiger sei als der Krieg gegen die Nazis. Das Ding ist nur, dass dieser Stephen Monk sich dabei immer als Hetero darstellt: tolerant, wie sich das für einen leftwing Intellektuellen gehört, aber eben doch in seiner sexuellen Identität gefestigt und fraglos auf der Seite der Frauen.
Aber wenn man sich nun die Sache mit den Frauen näher anschaut, wird es ziemlich mysteriös. Der Roman steigt ein mit der Szene, in der Stephen Monk seine umschwärmte Frau Jane auf einer Party in LA in flagranti mit einem Liebhaber ertappt. Das nimmt er zum Anlass, sie zu verlassen. Theatralisch packt er seine Koffer, verschwindet aus dem Leben von Jane und reist – zu einer Tante. Ein Verhaltensmuster, das den Lesern von 1954 ziemlich weiblich („weibisch“?) vorgekommen sein wird, auch heute wird man es nicht übermäßig hetero finden. Bei der lieben Tante hat Stephen einen Unfall, bricht sich ein Bein und bleibt monatelang ans Bett gefesselt.
Dort denkt der 37-Jährige ausgiebig über seine Vergangenheit, vor allem aber über das Leben mit seiner ersten Frau, der berühmten Schriftstellerin Elizabeth Rydal, nach. Wenn Jane ein mondänes Flittchen, also die klassische Hure, war, so darf die edelmütige, alles verstehende Elizabeth als die klassische Heilige gelten; Nervensägen sind sie beide. Und Stephens Beziehung zu ihnen verläuft seltsam asymmetrisch: Einer männlichen Galatea gleich, schildert der Ich-Erzähler uns vor allem Elizabeth als seinen Pygmalion, der ihn überhaupt erst erschaffen oder doch zum vollwertigen Menschen gemacht hat („Du hast mich erfunden“). Dass Elizabeths Allverzeihen so weit geht, sogar Verständnis für Stephens kurze Affäre mit Michael zu haben, setzt dann dem unglaubwürdigen Ganzen die Krone auf.
Zu der allgemeinen Vernebelung kommt noch hinzu, dass der Roman mit seinen vielen Zeitbrüchen, weitschweifigen Schilderungen von Gesprächen (speziell über Eheprobleme) die Kulisse eines Zeit- oder auch Gesellschaftspanoramas aufbaut, vor der dann auch hübsch boshafte Kommentare zum Talmiglanz der amerikanischen Neureichen, Einblicke ins Quäker-Milieu, in dem sich Stephens Tante ehrenamtlich engagiert, oder eben der bereits erwähnte schwulenemanzipatorische Diskurs stattfinden. Doch die wirkliche Frage, die den Leser beschäftigt und die Stephens zeitweiliger Lover Michael auch aufwirft, die Frage, ob Stephen nicht schwul ist und mit seinen Ehen nur unnötige Umwege geht – diese Frage wird bis ans Ende der nahezu 400 Seiten nicht beantwortet.
Das mag den Leser von 1954 enttäuscht haben. Heute, wo zumindest die Literaturwissenschaftler und avancierteren Leser den Begriff des „unzuverlässigen Erzählers“ kennen, der den „Pakt mit dem Leser“ aufkündigt, ihn vielmehr in die Irre führt, liest sich der Roman außerordentlich reizvoll. Vor allem als schwuler Leser nimmt man dem reichlich queer daherkommenden Ich-Erzähler Stephen sein ausgestelltes Heterosein (samt Schimpfkanonaden gegen „schwuchtelige, kleine Dreckskerle“) nämlich immer weniger ab. Doch war Isherwood wirklich seiner Zeit auch literarisch so weit voraus, dass er einen „unzuverlässigen Erzähler“ erfand? Muss man den Roman „Die Welt am Abend“ nicht viel eher als Dokument seiner großen Sinnkrise zwischen den Berliner Jahren und dem endlich erfolgten Coming-out mit „A Single Man“ von 1964 lesen, einer Sinnkrise, die ihn ja auch zu dem hinduistischen Mönch Swami Prabhavanada führte? Nun, das muss jeder Leser für sich selbst entscheiden. Ein interessantes Selbstexperiment ist die Lektüre auf jeden Fall.

Die Welt am Abend
von Christopher Isherwood
Aus dem Englischen von Hans Christian Oeser
Pappband mit Schutzumschlag, 384 Seiten, 24 Euro,
Hoffmann und Campe