Pirkko Saisio: Das rote Buch der Abschiede
Buch
Eine Protagonistin sucht in Helsinki nach der Liebe und kämpft um Selbstbestimmung – zu einer Zeit, in der Kunst und Kommunismus eine unheilvolle Allianz bilden und queeres Begehren nur im Untergrund stattfindet. Mit dieser autobiografisch grundierten Erzählung rührte die Autorin Pirkko Saisio in „Punainen erokirja“ im Jahr 2003 den Kulturbetrieb ihrer finnischen Heimat auf und wurde dafür prompt mit dem Finlandia-Preis, einer der renommiertesten Literaturauszeichnungen des Landes, bedacht. Jetzt ist der Roman unter dem Titel „Das rote Buch der Abschiede“ erstmals in deutscher Übersetzung erschienen. Anja Kümmel hat sich von der Stimme der Erzählerin in einen Dschungel verschiedener Perspektiven und Zeitebenen entführen lassen.
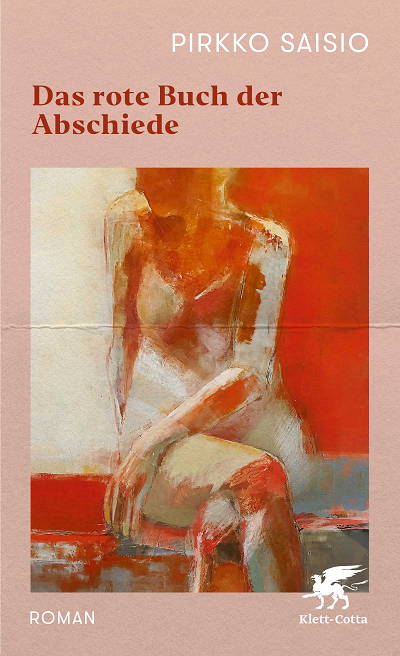
Zwischen den Zeilen
von Anja Kümmel
Ein augenzwinkerndes Hin und Her zwischen Autorin-Ich und jüngerem Alter Ego ist das prägende stilistische Merkmal von Pirkko Saisios „Das Buch der roten Abschiede“. „Sie (das bin ich)“, heißt es ziemlich zu Beginn des autofiktionalen Romans. Dieses Spiel mit den Erzählperspektiven bleibt Programm. Mal wechseln „sie“ und „ich“ einander ab, mal stehen sie nebeneinander, mal überlagern sie sich.
„Wollte sie das überhaupt?
Ich weiß nicht. Doch, ich weiß es.
Sie wollte es.
Ich wollte aus dem Schatten treten.“
Zunächst mögen diese Perspektivwechsel irritieren, doch indem sie entweder Distanz schaffen oder Nähe herstellen, geben sie die Mechanismen des Erinnerns stimmig wieder, um die es in dem Buch geht. Ähnlich verfährt die Autorin mit Zeitebenen. Die Handlung springt oft unvermittelt zwischen 2001/2002 und den 1970er und 1980er Jahren hin und her. Nur manchmal werden Jahreszahlen genannt, öfter jedoch muss man zwischen den Zeilen lesen, um eine Szene in einer bestimmten Epoche zu verorten: Da kreist eine Jaffa-Limonade und es werden Ringelshirts von Marimekko getragen, es tauchen „nach sowjetischem Desinfektionsmittel riechende Flüssigseife“ oder „strenge Knopfreihen und spitze Schulterpolster“ auf, dann wieder wird ein Spartakuslied aus der DDR angestimmt. Es dauert eine Weile, bis sich aus alledem einzelne Erzählstränge herauskristallisieren: Die Geburt des „Sonntagskindes“ im Jahr 1981, zwei zentrale Beziehungen der Erzählerin, zu „Clownauge“ und zu Havva, ihr Pfad durchs Theater und hin zum Schreiben, all das eng verwoben mit den politischen Entwicklungen und Umbrüchen in Finnland.
In ihrer finnischen Heimat ist Pirkko Saisio, Jahrgang 1949, Autorin, Schauspielerin und Regisseurin, schon lange eine bekannte Persönlichkeit. Hierzulande kann man ihr Schreiben erst mit diesem Buch entdecken, das eigentlich den Abschluss einer Trilogie bildet. In den ersten beiden Bänden, deren Übertragung ins Deutsche derzeit in Arbeit ist, spielt Saisios Kindheit in einem ärmlichen Arbeiterviertel Helsinkis eine größere Rolle. In „Das rote Buch der Abschiede“ wird dieser Hintergrund nur angedeutet und spiegelt sich vor allem in der schwierigen Elternbeziehung. Zwanzig Jahre sind seit der Veröffentlichung des Originals vergangen. So ist die Erzählgegenwart, aus der das Autorin-Ich auf ihre Erzählfigur zurückblickt, für uns nun auch schon wieder in die Vergangenheit gerückt, was gleichsam eine zusätzliche Zeitebene in den Text einzieht.

Pirkko Saisio – Foto: Laura Malmivaara
Zwischen den Zeilen zu lesen ist aber nicht nur eine Kunst, die der Text den Leser:innen abverlangt, es ist für eine queere Person im Finnland des Jahres 1970 auch eine zentrale Überlebensstrategie. In Helsinki, wo das Geschehen überwiegend spielt, trifft die junge Erzählerin in einem Kellerclub zum ersten Mal auf so etwas wie eine queere Community – hier tanzen Jungs mit Jungs und Mädchen mit Mädchen, und manchmal weiß man nicht so genau, wer ein Mädchen und wer ein Junge ist. Man erkennt einander anhand subtiler Codes; den Club darf man nur einzeln betreten und verlassen, nachdem ein Späher die Luft für rein erklärt hat.
„Sie hat ein sonderbares Zuhause gefunden“, schreibt Saisio: „Es ist ein geheimes Zuhause, und es ist kriminell.“ Doch genau diesen Zustand genießt „sie“, das literarische Alter Ego aus den vergangenen Jahrzehnten, so sehr, dass sie beinahe enttäuscht ist, als Homosexualität 1971 aus dem finnischen Strafgesetzbuch gestrichen wird. Aber warum will sie trotzig „eine Kriminelle bleiben“? Saisios Erklärungsansatz: „Wenn sie nicht kriminell sein kann, ist sie überhaupt nichts mehr.“
Die Ambivalenzen von Gemeinschaft und Zugehörigkeit bilden einen roten Faden, der den Roman durchzieht. In ihrer Herkunftsfamilie gibt es keine Begriffe für ihr Anderssein. Nachdem sie ihre erste Geliebte mit dem Spitznamen „Clownauge“ mit nach Hause gebracht hat, fragt ihre Mutter, nach mehreren Anläufen, „was das eigentlich für eine Sache ist“, „die Sache mit dem Mädchen“. Und als die Erzählerin erwidert: „Die Sache ist so, wie du denkst“, hat diese Antwort zur Folge, dass die Mutter ihre Zimtschnecke fallen lässt und die Tochter mit harten Worten aus dem Haus wirft: „Fass mich nicht an! Nie wieder.“
Diese Szene ist gerade wegen der nüchternen Lakonie, mit der Saisio sie schildert, brutal – doch keineswegs so endgültig, wie sie zunächst scheint. Ein paar Seiten später sitzt die Erzählerin wieder mit am Familientisch, wenn auch unter der Bedingung: „keinen Mucks von deinem Firlefanz“. Sie darf körperlich anwesend sein, aber sie darf sich nicht zeigen. Als sie – wieder eine unbestimmte Zeit später – von einem schweren Hautausschlag geplagt wird, reibt ihr die Mutter liebevoll den Rücken ein und bezahlt ihr das Taxi ins Krankenhaus. Gleichzeitig spricht sie aber auch homophobe Vorwürfe aus: „Deine Frauengeschichten. Die sind schuld daran, oder?“
Die Ausschlüsse in diesem Text sind selten so kategorisch, wie sie scheinen. Aber auch die Akzeptanz ist selten vollkommen. Oder sie hat einen hohen Preis. Als erste in ihrer Familie studiert die Erzählerin; sie entdeckt den geheimen Kellerclub, bewegt sich zwischen intellektuellen, weltgewandten Queers. Doch die Euphorie über die neu gefundene Wahlfamilie bekommt bald Risse: „Sie gehört hier nicht her, in diese Welt aus Teak, grünem Tee und locker eingestreuten kulturellen Anspielungen.“ Diese tragische Dynamik der mehrfachen Entfremdung erinnert an die autofiktionalen Erzählungen von Annie Ernaux oder Édouard Louis.
Aus jeder Zeile klingt die Sehnsucht der Erzählerin, anzukommen, angenommen zu werden, sie selbst sein zu dürfen. Doch jedes Ankommen bleibt zwangsläufig illusionär, flüchtig, unvollkommen. In der Welt des Theaters etwa wird „der Hunger ihrer Poren“ gestillt: Hier liegen alle stundenlang als riesiger Kuschelhaufen auf Matratzen herum und streicheln einander – für die Erzählerin eine ungemein befreiende Erfahrung. Gleichzeitig entfremdet sie das Eintauchen in diesen neuen Kreis mehr und mehr von „Clownauge“, reißt sie heraus aus ihrer Zweierbeziehung. Zumal „ziellose, privatistische Peinlichkeit“ sich nicht mit den hehren Idealen der kommunistischen Revolution verträgt, die den ideellen Nährboden der zweiten wichtigen Beziehung mit Havva bildet. Saisio erzählt sie vom Ende her. Auch diese Verbindung oszilliert zwischen Euphorie und Enttäuschung, Nähe und Distanz. Havva hat sich nicht nur mit Haut und Haar der sozialistischen Bewegung verschrieben, sondern auch ihrer persönlichen Freiheit. Sie proklamiert Sätze wie: „Du kannst einen Menschen nicht besitzen“ oder „Ich habe auch noch ein eigenes Leben. Versuch das zu kapieren.“
Die Erzählerin schweigt, wartet, leidet, eine echte Aussprache findet nicht statt. Ist es so schwer, mag man sich heute fragen, über unterschiedliche Bedürfnisse zu sprechen? Kompromisse auszuhandeln? Wieso scheinen die Fronten von Anfang an derart verhärtet? Ausgerechnet, als schließlich das „Sonntagskind“ geboren wird, driften die beiden Frauen auseinander. Auch hier fehlt es an Sprache, an Denkfiguren, an Vorbildern, ähnlich wie zehn Jahre zuvor zwischen Mutter und Tochter. Aber wo sollten sie um 1980 auch herkommen, die Schablonen für nicht-heteronormative Beziehungsformen, für queeres Familienleben, für Polyamorie jenseits naiver (von heterosexuellen Cis-Männern erdachter) Hippie-Utopien? Die große Kunst der Autorin besteht darin, vom Scheitern an der Sprachlosigkeit ganz ohne Larmoyanz zu erzählen.
Die weiteren Stärken des Textes sind die Literarisierungen und Poetisierungen der Sprunghaftigkeit von Erinnerungen. Saisio erhebt sie zu einem zentralen Teil ihrer Dramaturgie, bis hin zum Schriftbild: Mal tröpfelt die Erinnerung zäh und widerwillig herein, dann wieder bricht ein Damm und sie strömt förmlich übers Papier. So kommt es öfter vor, dass eine Passage mitten im Satz abbricht, auf ein „Und“ eine Leerzeile folgt, und der Gedanke erst später wieder aufgegriffen wird. Am besten funktioniert „Das rote Buch der Abschiede“ wahrscheinlich laut vorgelesen. Oder man stellt sie sich einfach vor, die Stimme der sich erinnernden Erzählerin, die mal innehält, um ihre Gedanken zu sammeln, mal schmunzelnd über sich selbst den Kopf schüttelt, mal in Klammern eine Ergänzung einfügt, mal nostalgisch in aller Detailverliebtheit in einer bestimmten Begebenheit schwelgt. Diesem mündlichen Duktus ist die Theatererfahrung der Autorin anzumerken.
Saisios glasklare, einfache Sprache und ihr parataktischer Stil lassen jeden Dialog und jeden Vorgang lebendig werden. Jede Szene brennt sich ein, die Zwischenstücke hingegen bleiben bisweilen vage, sodass man sich die Hintergründe und fehlenden Puzzleteile selbst zusammenreimen muss. Der Autorin liegt mehr daran, die emotionalen Höhe- und Tiefpunkte des eigenen Lebens zu beleuchten, als sich mit dem Herstellen von Zusammenhängen zu befassen. Lücken und Ambivalenzen auszuhalten ist ja letztendlich auch das, was „ich“/„sie“ immer wieder lernen muss. So verweisen die „Abschiede“ des Titels nicht nur auf das Ende von Beziehungen, das Hinter-sich-Lassen bestimmter Lebensabschnitte oder den Verlust geliebter Menschen, sondern vor allem auf die sowohl schmerzhafte als auch befreiende Verabschiedung von Gewissheiten.

Das rote Buche der Abschiede
von Pirkko Saisio
aus dem Finnischen von Elina Kritzokat
Hardcover, 304 Seiten, € 25,
Klett Cotta Verlag
