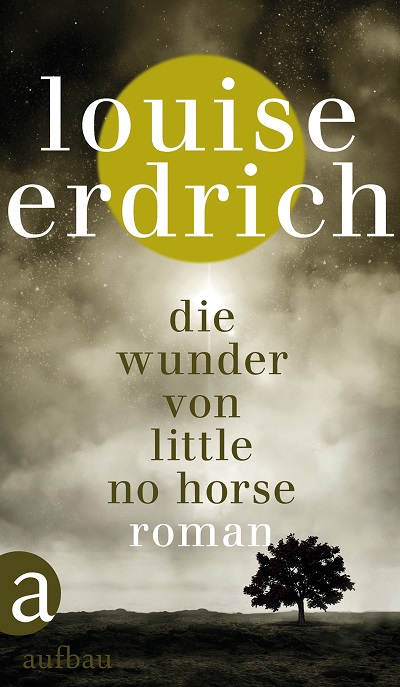Louise Erdrich: Die Wunder von Little No Horse
Buch
Nach einem Unwetter nimmt die Farmerswitwe Agnes die Identität des katholischen Missionars Father Damien an und leitet bis ins hohe Alter eine kleine Gemeinde im Indianerreservat. Der bereits vor 20 Jahren verfasste Roman „Die Wunder von Little No Horse“ der amerikanischen Autorin Louise Erdrich dringt tief in die Persönlichkeit seiner Heldin ein, die ihr wahres Geschlecht verleugnet, um Gott zu dienen. Der Vergleich zu Michael Roes‘ Roman „Herida Duro“ (2019) drängt sich auf und zeigt große Unterschiede. Michael Sollorz ist Louise Erdrich in die Trostlosigkeit des Indianerreservats gefolgt.
„Nie etwas erklären. Keine Erklärungen akzeptieren.“
von Michael Sollorz
North Dakota anno 1912. Gleich am Beginn eine Apokalypse. Der mächtige Red River tritt über seine Ufer und reißt Mensch und Vieh mit sich fort, auch die Farmerswitwe Agnes und ihren Flügel, auf dem sie gestern noch so leidenschaftlich Chopin spielte. Kein Stein bleibt auf dem andern, nichts hält der Verwüstung stand. Die große Flut ersäuft auch einen Priester, beordert nach Little No Horse, zur Mission zum Heiligen Herzen, wo Reservats-Indianer in der katholischen Lehre unterwiesen werden.
Dass Agnes überlebt, muss der gläubigen jungen Frau wie ein Wunder erscheinen. Was hat Gott mit ihr vor? Sie findet den toten Priester, nimmt seine Soutane, seine Papiere, und macht sich an seiner statt auf den Weg zu den Nonnen und Ureinwohnern. „Von jenem Tag an sollte Agnes St. Dismas immer im Kalender anstreichen, weil es ihr erster Erdentag als Father Damien war, der erste Tag der großen Lüge, die nun ihr Leben war – der wahren Lüge, so sah sie es, der aufrichtigsten Lüge, die je erzählt wurde.“
Was Agnes vorfindet, die kleine Missions-Station am Rand des Reservats, ist in hoffnungslosem Zustand. In der traurigen kleinen Kirche hocken frierend die Nonnen beim Morgengebet. „Ihre stumpf dreinblickenden Gesichter waren die Schlünde hungernder Tiere, ihre Finger schlaff wie welkende Zweige. Die Gestalt ihrer Schädel, ihre faltigen Hände ließen keinen Zweifel, dass der Tod selbst durch ihre Haut zu schimmern begann.“ Kein Deut besser steht es um die Indianer. Sie haben keinen Sinn für das Eigentum, alles ist ja nur geliehen. Sie verscherbeln ihr Land an clevere Weiße, ohne auch nur die Verträge lesen zu können, die sie unterschreiben. Selbst vegetieren sie in Kälte und Hunger, viele krank vom Schnaps. Seuchen grassieren. Wo, wenn nicht hier, täte Beistand Not? Agnes, in ihrer neuen Identität, nimmt die Herausforderung an und bleibt, sie bleibt bis zum Ende. Da ist sie dann über hundert Jahre alt, ein sonderbares Greislein.

Louise Erdrich – Foto: Pau Emmel
Louise Erdrich kennt, wovon sie in ihren Romanen erzählt. Sie ist die Tochter einer Indianerin und eines Deutschen, ihr Vater arbeitete in der Verwaltung eines Reservats und gab Unterricht, Mutter kümmerte sich um Kinder aus Säufer-Familien. Die erfolgreiche Autorin (Jahrgang 1954) lebt im US-Bundesstaat Minnesota, wo sie unter anderem eine Buchhandlung betreibt. In ihrem literarischen Werk dominieren opulente Tableaus, in denen man schmökernd versinkt. Im dramaturgischen Sinn lässt sie ihrem Stoff die Leine locker, gestattet sich Abschweifungen, Nebenhandlungen, bestes Lesefutter, oftmals überraschend und von berührender Sinnlichkeit. Zuweilen trägt der Text Züge eines Deliriums, vom Magischen Realismus nicht unberührt, was durchaus seinem Anliegen dient. Denn es geht um die Aufweichung von Grenzen, Grenzen etwa zwischen dem, woran wir glauben, und dem, was wir zu wissen meinen.
Nach Jahrzehnten beharrlicher Arbeit hat Agnes ihre Gemeinde einigermaßen auf Vordermann gebracht, da entsendet die ferne Kirchenleitung Father Jude, einen jüngeren Priester, der Nachforschungen anstellen soll zu einer längst verstorbenen Nonne aus Little No Horse. Vermochte jene sagenumwobene Schwester Leopolda wirklich Wunder zu vollbringen? Ihre Heiligsprechung ist angedacht. Father Jude hat den Auftrag, Wissen anzusammeln, doch je mehr er erfuhr und je länger er nachdachte, desto weniger Gewissheit blieb ihm. Selbstverständlich wendet sich der Gesandte zuvorderst an seinen ansässigen Amtskollegen, diesen irgendwie ungreifbaren und rätselhaften Alten. „Es mag einem ungewöhnlich erscheinen, dass ein neugieriger und leidenschaftlicher Mensch, denn ein solcher bin ich, ein Leben in Enthaltsamkeit wählen sollte. Doch in meinen Augen ist daran gar nichts Besonderes, denn die Wahl selbst habe ich aus Lust getroffen. Aus Passion für die Passion. Um so hungriger nach Gott bin ich hierhergekommen …“
Hält sich dieser Father Damien überhaupt noch an die Regeln? Zumindest fungiert er offenbar „nicht als freudlose Marionette des Dogmas“, sondern ist ein Priester des Mitleids, der Gemeinsamkeit, ein nachsichtiger Seelsorger im besten Wortsinn, der noch jedem armen Sünder Vergebung gewährt. Außerdem erlernt er die Sprache der Indianer und übernimmt manches von ihnen für sich und seine Religion. Er hat Brücken gebaut und „praktizierte jetzt eine Mischung zweier Traditionen, ehrte die Pfeifenrituale, übersetzte Kirchenlieder oder ließ die Trommel spielen und hatte in seiner Kirche eine Statue der Heiligen Jungfrau aufgestellt, die erdverbunden und rätselhaft war, freundlich, hässlich und sanft.“ Die harten North-Dakota-Winter begraben das Reservat unter Schnee. Doch Agnes hockt nicht hinterm warmen Ofen, sie muss hinaus zu ihren Schützlingen. „Nanapush hatte Father Damien beigebracht, wie man Rahmen für Bärenpfoten-Schneeschuhe baute und sie mit Elchdärmen und Sehnen bespannte.“
Die Recherche des Ermittlers gerät ins Stocken. Bald sieht er ein, „dass eine Lebensgeschichte als Geschichte aufzuschreiben immer bedeutete, einen einzigen Faden aus dem bunten Muster herauszugreifen und den Rest – das ganze herrliche, grausige Geflecht menschlicher Gegensätze – als ungültig außen vor zu lassen.“ In den Befragungen scheint der greise Father Damien etwas zu verbergen. Tatsächlich, einst stellte Schwester Leopolda, unberechenbar und biestig, für Agnes eine Bedrohung dar. „Sie haben die Stimme eines Priesters, aber diese Augen, die können Sie nicht täuschen. Sie benehmen sich wie ein Mann, gar nicht weiblich, doch Ihr Nacken bleibt dürr. Die Haut ist zu schlaff für den Hals eines Mannes. Ich weiß genau, dass Sie Brustbinden tragen. Und dass Sie nicht die Ausstattung eines Mannes haben, obgleich sie bei einem Priester ohnehin überflüssig ist.“ Dabei hatte sich Agnes in all den Jahren so sehr bemüht, der Welt die Wahrheit ihres Körpers zu verbergen. „Jeden Morgen, wenn sie sich verwandelte, überkam sie ein Gefühl des Verlusts, das sie schließlich als den Verlust von Agnes erkannte.“ Anfangs notiert sie sich Verhaltensregeln, die bei ihrer Verwandlung helfen sollen. Heraus kommt ein drolliger Katalog männlicher Makel. „Nie etwas erklären. Keine Erklärungen akzeptieren.“
Im Zusammenhang mit der Durchführbarkeit solch lebenslangen Versteckspiels verweist Louise Erdrich in ihrer Nachbemerkung übrigens auf eine Biografie der amerikanischen Literaturwissenschaftlerin Diane Middlebrooks, die vor zwanzig Jahren auch auf Deutsch bei Malik erschienen und antiquarisch noch günstig zu bekommen ist: „Er war eine Frau – Das Doppelleben des Jazzmusikers Billy Tipton“. Dieser als Dorothy Lucille Tipton geborene Pianist und Saxophonist begann Anfang der Dreißiger Jahre des vergangenen Jahrhunderts, gerade mal Zwanzig, in Kansas City mit einer Band aufzutreten – als Mann. Doch bei der Bühnenrolle blieb es nicht. Außerdem war er fünfmal verheiratet. Seine sexuelle Zurückhaltung begründete er den Ehefrauen mit einer Verstümmelung infolge eines Autounfalls und adoptierte drei Jungs. Seine Frauen, die Band, die Söhne – sie alle erfuhren erst nach seinem Tod im Jahre 1989 vom Geschlecht, das ihm bei seiner Geburt zugewiesen wurde. Warum Tipton diesen schweren Weg gegangen ist, gibt bis heute Rätsel auf.
Auch Agnes hadert. Mehr als einmal fragt sie sich: „Wo blieb Gott in diesem Chaos?“ Immer wieder schreibt sie nach Rom an die wechselnden Heiligen Väter. Niemals kommt Antwort. Das Schweigen des Papstes ist das Schweigen Gottes. In einem Brief heißt es: „Viele der hiesigen Indianer brauchen mich mittlerweile. Ich wüsste wahrhaftig niemanden, der meine Stelle einnehmen könnte, niemanden, dem ihr Wohlbefinden und ihr Glaube so sehr am Herzen lägen – ich werde einer von ihnen, auf dass ich ihnen umso besser den Weg in den heiligen Leib der Kirche weisen kann. Und je näher ich ihnen komme, desto stärker empfinde ich ihre Schmerzen.“
Agnes ringt mit der Versuchung, den Priesterrock an den Nagel zu hängen. Ihr Körper schreit nach Befreiung, sie träumt von einem Leben als Frau und Geliebte. Doch was würde nach so einem Verrat aus den Früchten ihrer Arbeit? „Als Father Damien hatte sie Ehen geschlossen, getauft, gesalbt und ihre Freunde in der Gemeinde von ihren Sünden freigesprochen. Er war an Orten willkommen, die sonst kein Weißer betreten durfte.“ Geriete nicht durch ihre Entlarvung all das gute Tun in Zweifel, wären die Paare entzweit, die Kinder ungetauft, die Toten ohne Segen begraben? So entscheidet sich Agnes immer wieder für die Pflicht und bleibt bei den ihr anvertrauten Menschen. Zum Schutz ihrer Rolle deckt sie schließlich sogar einen Mord, den Schwester Leopolda begangen hat, und am Ende, um ihr Werk vor Diffamierung zu schützen, entscheidet sich Agnes für ihr spurloses Verschwinden. Ein langes Leben steht auf dem Prüfstand. War es all die Mühe wert? „Egal, was sie getan hatte, egal, wie viele Seelen sie gerettet oder im Stich gelassen hatte, ob sie ihre weibliche Natur verraten oder die Gelübde des längst verstorbenen ersten Father Damien gebrochen hatte, ihr Leben war nichts als Rauch, ohne jede Substanz, eine Note in einer endlosen Komposition, eine Note, die verklang, ehe ein Zuhörer ihre Gestalt wahrnehmen konnte. Wer war diese Agnes oder dieser Father Damien, diese Überlagerung von Laub und Erde?“
Allenthalben, wie erwähnt, verschwimmen Grenzen. Gut und Böse changieren im wechselnden Licht. Die Nonne, die eine Mörderin war. Der allseits verehrte Geistliche, insgeheim eine Frau. Blasphemie oder Heldenstück? Gib es weibliches Schreiben, männliches Lesen? Richtiges Leben im falschen? Scheinbar Feststehendes verkehrt sich ins Gegenteil, untrennbar und unbemerkt verschmelzen Wahrheit und Lüge. Agnes‘ Erfahrungen weiten ihre Wahrnehmung. „Jedes Ding ist belebt oder unbelebt, was einem zunächst erstaunlich einfach und vernünftig erscheinen mag, da wir Weißen glauben, Lebendes und Lebloses sei leicht zu unterscheiden. Weit gefehlt.“ Denn auch Steine oder Kleidungsstücke sind für die Indianer nicht unbeseelt. In ihrer Spiritualität begreifen und benehmen sie sich als kleiner Teil des gesamten Naturzusammenhangs.
In der Annäherung an diese Fragen entfaltet der Roman seine Dimension. In seinen fein gesponnenen Verästelungen und Zwischentönen handelt er vom uralten Menschentraum der Entgrenzung. Wir sehnen uns nach Transzendenz, nach dem Ablegen trennender Panzer, wie der Herkunft, der Rasse und dem Geschlecht, ganz zu schweigen von der sexuellen Orientierung. Nach einem verbindenden Sinn. Eingangs heißt es über Agnes: „Sie spürte auf dem Weg in ihr neues Leben etwas Großes durch sie hindurchgehen, erkannte sich als Bestandteil eines ruhigen, weit ausgreifenden Musters, einer Bedeutung bis jenseits des Horizonts.“ Gottes Plan, mögen es die Christen nennen. Buddhisten verwenden den Begriff des Interseins, um zu beschreiben, wie wir in allem enthalten sind, was uns umgibt.
Als Louise Erdrich „Die Wunder von Little No Horse“ schrieb, war das Bewusstsein für die irreparable Beschädigung des Lebensraums Erde insgesamt noch weniger stark entwickelt. Erst kürzlich wurde ihr hellsichtiger Roman ins Deutsche übersetzt, es erschien bereits vor 20 Jahren in den USA. Dieser Tage meutern deutsche Katholiken gegen das Zölibat. Priester sollen heiraten dürfen, auch Frauen ordiniert werden. Unablässig zeigen Fernsehnachrichten neue Schreckensbilder von tückischen Anomalien des Wetters, überall auf unserer Welt. Und auf einmal, nach der Lektüre des dicken Buches, sehen wir Agnes ermutigend lächeln. Die Figur hat sich tief eingeprägt. Sie ist es nämlich, die heiliggesprochen gehört. Sie hat uns schon vorgelebt, was wir erst noch lernen müssen. Unsere schnellen Antworten zurückzuhalten, in Demut. Unsere Egoismen zu überwinden. Und dass künftig kein Wir mehr eine Hautfarbe hat.

Die Wunder von Little No Horse
von Louise Erdrich
Gebunden, 509 Seiten, 24 €,
Aufbau Verlag