Christopher Isherwood: Begegnung am Fluss
Buch
55 Jahre nach Erscheinen der englischen Originalausgabe von „A Meeting by the Lake“ und 42 nach der deutschen Erstübersetzung ist Christopher Isherwoods letzter Roman in einer Neuausgabe erschienen. Die Übersetzung stammt von Hans-Christian Oeser, wie schon jene für Isherwoods autobiografisch grundierte Erzählung „Die Welt am Abend“ vor drei Jahren. So ist aus dem einstigen „Treffen am Fluss“ eine „Begegnung am Fluss“ geworden und die Sprache wurde von ein paar altertümlichen Schlacken befreit. Übrig bleibt die Geschichte einer ambivalenten Hassliebe zweier ungleicher Männer vor indischer Kulisse. Marko Martin hat sich von der erstaunlich heutigen Geschichte des schwulen Kultautors irritieren, provozieren und anfrösteln lassen.
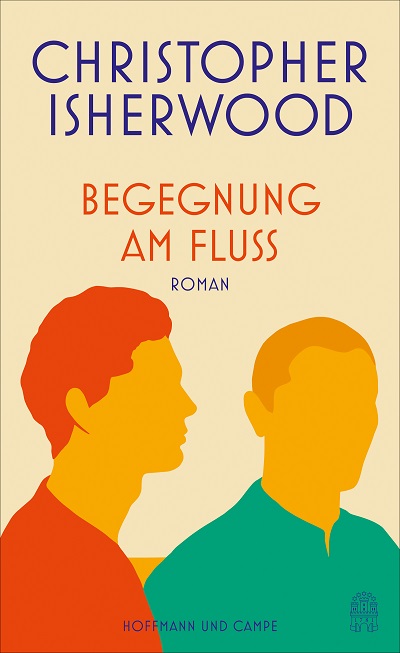
Tempelzeremonie im Kältestrom
von Marko Martin
Sie sind Brüder, sie nennen einander „Olly“ und „Paddy“, der eine ist ein stiller Sinnsucher in einem indischen Hindu-Tempel, der andere ein bisexueller Globetrotter, der seine tolerante Ehefrau „Penny“ ruft, während beide ihre Sohnespflichten erfüllen und der „lieben Mutter“ regelmäßig Briefe nach London schicken. Soweit das Hauptpersonal in Christopher Isherwoods 1967 erstmals erschienenem Roman „Begegnung am Fluss“. Eine Patchwork-Family avant la lettre? Nichts weniger als das. Doch während die abwesenden Frauen als Briefadressatinnen stumm bleiben, zeigt sich in der Red- und Schreibseligkeit der beiden ungefähr mittdreißigjährigen Brüder vor allem eins: eine immense Hassangst gegenüber dem jeweils anderen, verbunden mit einer vermutlich schon seit Kindheits- und Jugendtagen immer wieder neu verletzten Selbstliebe. Auch ein halbes Jahrhundert später, in der überaus gelungenen, von altertümlichen Schlacken befreiten neuen deutschen Übersetzung von Hans-Christian Oeser, dringt ein Kältestrom aus diesen Seiten.
Lange Zeit haben die Brüder einander nicht gesehen, nun kommt es zu einer Wiederbegegnung in der Nähe von Kalkutta. Einigermaßen schwer zu sagen, wer in der darauffolgenden, zum Teil als Briefroman konzipierten Geschichte Abel ist und wer Kain. Da sie doch beide zuvörderst die Hüter ihrer ureigenen Befindlichkeiten zu sein scheinen, ihrer realen oder imaginierten Verletzungen (heute würde man wohl von „Mikroaggressionen“ sprechen) und den anderen hauptsächlich als Spiegel und Zerrbild der eigenen Wünsche, Phantasien und Phobien wahrnehmen. Patrick/„Paddy“ schreibt Konventionell-Pittoreskes an die gemeinsame Mutter, und spart sich das Sarkastische auf für seine Briefe an Penelope/„Penny“: Schmutzig, laut und übervölkert sei die Stadt, welcher der Abzug der Briten nicht gutgetan habe, während sein Bruder Oliver/„Olly“ der Schimäre einer abstrusen Seelenreinigung nachjage. Gehetzt indessen wirkt der eher pseudojoviale Weltmann Patrick, eine Art hektischer Selbstoptimierer – wobei es auch dieses Wort zu jener Zeit noch nicht gab.

Christopher Isherwood – Foto: Allan Warren/Wikipedia
Gerade diese zukunftsweisenden Aspekte sind es aber, die den Roman durchaus interessant und wohl auch haltbarer machen als so manch andere literarische Verfertigung aus der Zeit der ach so rebellischen Sechzigerjahre. Anstatt das undifferenzierte Hohelied auf den polyglott-multisexuellen Kosmopoliten Patrick zu singen, der sich erfolgreich der prüden viktorianischen Tradition entwunden hat, zeigt Christopher Isherwood ein feines Gespür für die Ambivalenzen einer solchen Existenz. Denn ist „Paddy“ nicht weiterhin Gefangener einer Konkurrenzlogik, ein kleines Rädchen innerhalb der Mechanik einer nie hinterfragten Aufmerksamkeitsökonomie? Der Mutter muss mitgeteilt werden, wie erfolgreich man ist als reisender Literaturagent (nunmehr sogar als einer, „der in Filmen macht“), die Ehefrau wird mit wohlgesetzten Nebenbemerkungen über die eigene Virilität bei erotischer Laune gehalten, und gegenüber dem jüngeren Geliebten Tom gilt es geradezu verzweifelt die Balance zu halten zwischen lebenskluger Gentleman-Attitüde und vermeintlich ungebrochenem jugendlichen Elan – ein Bild wie herausgeschnitten aus dem urbanen Jetzt medienaffiner Dreitagebart-Daddies mit Markenklamotten und mitunter dann doch sehr unruhig flatterndem Blick.
Als es schließlich zur Begegnung der beiden Brüder Patrick und Oliver kommt, widersteht Christopher Isherwood zum Glück der Versuchung, letzteren als lässig-souveränen Sinnsucher und -finder zu zeichnen, der im Kontakt mit tieferer östlicher Weisheit einem oberflächlich-schnöden westlichen Streben abgeschworen hat. Keine geringe Leistung zu einer Zeit, als vermeintlich authentisches Geigengezirp von London bis San Francisco erklang, selbst die Beatles nach Indien pilgerten und Hermann Hesse mit seinen romanesken Traktaten über „morgenländische“ Philosophie posthum zu neuem Ruhm gelangte. Isherwood nämlich wusste es aus eigener Erfahrung besser: Durch die Vermittlung eines zweitklassigen Krimiautors, der zuvor bereits Aldous Huxley mit einem hinduistischen Lehrer bekannt gemacht hatte, war der einstige Männerjäger vom Berliner Nollendorfplatz in enge Berührung mit jener Philosophie geraten, die (Homo-)Sexualität zwar nicht mit christlichen Sündebegriffen verdammt, jegliche Sinnlichkeit aber als störend für die angestrebten Stadien der Erleuchtung betrachtet. Im Jahr 1944 hatte sich Isherwood sogar in ein klösterliches Hindu-Center bei Los Angeles begeben – jedoch nur für kurze Zeit, da die Sache mit der sexuellen Enthaltsamkeit dann doch nicht so recht die seine war.
1967 ist Oliver in der „Begegnung am Fluss“ dann weder ein lächelnd Entsagender noch ein innerlich Zerrissener. Seine Tagebuchnotizen, die sich im Buch abwechseln mit Patricks Briefen, zeichnen dennoch keinen außergewöhnlich sympathischen Menschen. Denn ist nicht auch er ein Kalkulierender, der immer wieder in Gefahr gerät, seine spirituelle Existenz zur Spielmarke herabzuwürdigen, um seinen hektischen Bruder mit dem besseren Blatt auszustechen? Gewiss, Oliver hat Patrick die Gabe der Selbstreflexion voraus, doch sind nicht beide Brüder darin gleich, dass sie vor allem mit sich selbst beschäftigt sind und ihr Gegenüber nur in dem Maße wahrnehmen, das das eigene Selbstbild bestätigt oder gefährdet? Das mitunter allzu Ausufernde ihrer Betrachtungen ließe sich wohl als Rollenprosa rechtfertigen, provoziert letztlich aber auch Fragen nach der Perspektive des Autors. Liegt es tatsächlich allein an den reduzierten Blickwinkeln seiner beiden Antihelden, dass die indische Umwelt und die Einheimischen eher Staffage bleiben? So wohltuend nichteifernd die Darlegungen hinduistischer Weltanschauung auch sind, sie lesen sich dann doch wie aus einem Kulturreiseführer kopiert. Kein Vergleich jedenfalls zu einem Roman wie „Reise nach Indien“ von E. M. Forster. Im Unterschied zu diesem lebte Christopher Isherwood seine Homosexualität offen. Ob ihn das auch zu einem besseren Schriftsteller gemacht hat, bleibt Ansichtssache.
So rühmenswert es also ist, dass der Verlag Hoffmann und Campe Isherwoods Bücher in gelungenen Neuübersetzungen herausbringt, die „Begegnung am Fluss“ verbleibt trotz einiger gelungener Passagen voller Witz, Widerhaken und auch Schmerz thematisch dann doch allzu sehr im Voraussehbaren und sprachlich im Konventionellen, wenn nicht gar Drögen. So komplizenhaft-schelmisch der Blickkontakt zwischen den beiden Brüdern also schließlich auch ausfällt, als Patrick bei einer Tempelzeremonie Zeuge von Olivers Aufstieg zum geweihten Schwami wird – beim Lesen fühlt man sich ein wenig wie auf einem mäßig spannenden Abendempfang, der lediglich zum unterkühlten Pläsier der Gastgeber veranstaltet wurde.
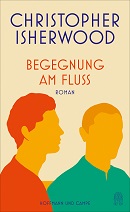
Begegnung am Fluss
von Christopher Isherwood
Aus dem Englischen von Hans-Christian Oeser
Gebunden, 205 Seiten, € 25
Hoffmann & Campe
