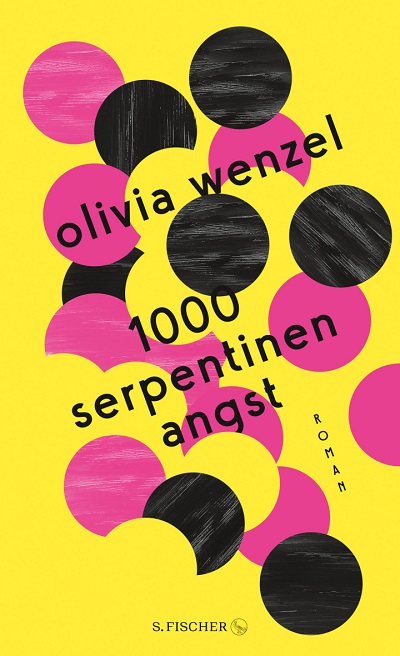Olivia Wenzel: 1000 Serpentinen Angst
Buch
Eine namenlose queere Ich-Erzählerin schaut mit Wut und Leidenschaft auf unsere sich rasch verändernde Zeit und erzählt zugleich die Geschichte ihrer Familie: von ihrer Kindheit in den späten 1980er und 90er Jahren in einer ostdeutschen Kleinstadt, mit einer jungen Punkerin als Mutter, einem angolanischen Vater und einer Großmutter, die zu DDR-Zeiten treue SED-Anhängerin war. In ihrem autofiktionalen Debütroman regt Olivia Wenzel ihre Leser_innen dazu an, das Narrativ stets kritisch zu hinterfragen und die Identitäten ihrer Figuren als fluide anzusehen. Anja Kümmel erkennt in Wenzels Art, von Angst- und Diskriminierungserfahrungen zu erzählen, eine literarisch eigenwillige Stimme.
Sprünge und Lücken
von Anja Kümmel
„Ist das wieder so’ne Geschichte, wo du was auslässt, und am Ende stimmt die Hälfte nicht?“, fragt die Protagonistin in Olivia Wenzels Roman „1000 Serpentinen Angst“ an einer Stelle ihre Mutter. Es ist die erste Begegnung nach jahrelanger Funkstille – oder entspringt der Dialog lediglich der Imagination der Erzählerin? Auch diese Möglichkeit räumt Wenzel ein. In jedem Fall verweist der Satz auf zwei zentrale Elemente dieses außergewöhnlichen Debüts: Zum einen die Instabilität und Lückenhaftigkeit der hier vorgestellten Biografie, zum anderen die radikale Absage an die klassische Romanform. Anstatt sich chronologisch durch klar definierte Räume zu bewegen, nähert sich Wenzel ihrer Hauptfigur fragmentarisch und sprunghaft an. Dass sie schwarz ist, aus der ehemaligen DDR stammt und nun, als Erwachsene, ziemlich viel in der Weltgeschichte herumreist, erschließt sich erst nach und nach.
Im ersten Teil etwa wartet die namenlose Ich-Erzählerin an einem namenlosen Bahnsteig – eine zunächst alltäglich wirkende Szene, die sich jedoch immer wieder surreal oder apokalyptisch verzerrt und wie ein traumatischer Loop die nächsten 120 Seiten durchtaktet. Auf einer zweiten Ebene werden wir mit Gesprächsprotokollen ohne festgelegte Sprechpositionen konfrontiert, die uns an weitere Nicht-Orte entführen.

Olivia Wenzel – Foto: Juliane Werner
Ein wiederkehrendes Motiv ist (im ersten Teil) ein Snack-Automat, der sich (im dritten Teil) in einen Kaugummi-Automaten verwandelt, vor dem die Protagonistin als Siebenjährige steht und davon träumt, einen Ring zu ergattern, mit dem sie wahlweise einem Jungen aus der Parallelklasse oder aber ihrer Lehrerin einen Heiratsantrag machen möchte. „Je länger ich ihn betrachte, desto jünger werde ich“, denkt sie, und fasst damit die gegenläufigen Bewegungen des Romans ziemlich treffend zusammen: Während wir der Protagonistin beim Aufwachsen zusehen, begleiten wir sie parallel bei einer – physischen wie mentalen – Reise in die eigene Vergangenheit.
Wie sie in den späten 1980er und 90er Jahren in einer ostdeutschen Kleinstadt aufwächst, als Kind einer jungen Punkerin und eines angolanischen Vaters, erfahren wir peu à peu. Dass sie einen Zwillingsbruder hatte, der sich mit 19 das Leben nimmt. Von den rassistischen Anfeindungen, denen die Zwillinge ausgesetzt sind. Dass der Vater kurz nach der Geburt der Kinder in seine Heimat zurückgeht und die Mutter unter nie ganz geklärten Umständen von der Stasi verhaftet wird. Regelmäßigen Kontakt pflegt Wenzels Hauptfigur in der Erzählgegenwart nur noch mit ihrer Großmutter, zu DDR-Zeiten eine treue SED-Anhängerin, die davon träumte, Stewardess zu werden, und jetzt unter Flugangst leidet und kaum noch das Haus verlässt.
Als „Autofiktion“ hat Wenzel ihren Debütroman in mehreren Interviews bezeichnet; und so gehört das spielerische Offenlassen des biografischen Wahrheitsgehalts zum zentralen Strukturprinzip des Buches. Dass die 1985 in Weimar geborene Autorin aus dem Theaterbereich kommt, merkt man ihrer assoziativen Dramaturgie, vor allem aber den Dialogen (oder inneren Monologen) an, die einen Großteil der Textmenge ausmachen. Bezeichnend, dass sich die Protagonistin den Festlegungs- und Zuschreibungsversuchen der Selbst- oder Fremdbefragungen immer wieder geschickt entzieht. „WAS UNTERSCHLAGE ICH JETZT?“ kann provokant oder nachdenklich gemeint sein, ebenso „HALTE ICH INFORMATIONEN ZURÜCK?“ – in jedem Fall sind die Leser_innen dazu eingeladen, das Narrativ immer wieder kritisch zu hinterfragen, die Identitäten der Figuren als unabgeschlossen und fluide zu begreifen.
Mit Anfang 30 pflegt die Ich-Erzählerin in Berlin, sporadisch auch in New York, einen ziemlich (selbst)destruktiven Lebensstil, inklusive Alkohol, Drogen und One-Night-Stands. Erst eine unerwartet ausbrechende Angststörung zwingt sie dazu, auf „Pause“ zu drücken und sich ihrer Vergangenheit zu stellen. Dazu gehört nicht nur eine Wiederannäherung an die psychisch labile Mutter; auch ihre Ex-Freundin Kim, eine junge Frau mit vietnamesischen Wurzeln, taucht wieder in ihrem Leben auf. In Rückblenden erfahren wir von der sich über Jahre hinweg anbahnenden Beziehung, die sich graduell von einer platonischen Freundschaft hin zu einem romantisch-sexuellen Verhältnis entwickelt. Graduell vor allem deswegen, weil sich die Protagonistin ihr queeres Begehren lange nicht eingesteht, sich stattdessen einredet, „dass ich eigentlich nicht in die nächste marginalisierte Randgruppe gehörte“.
In Fragmenten erfahren wir auch von dem Bruch zwischen beiden, wie sich die Erzählerin gegen jegliche Nähe wehrt und diese nach Möglichkeit kaputtzumachen sucht. „Unsere Abgründe ähneln einander“, summiert sie lakonisch ihre Anziehung zu Kim – was nicht zuletzt damit zu tun hat, dass beide sich permanent mit Rassismus und Mikroaggressionen im Alltag auseinandersetzen müssen, ob sie wollen oder nicht. Etwa wenn sie zusammen ein Theaterstück über die Wendezeit anschauen und mit einem Blick ins Publikum feststellen, dass sie „die einzigen Nichtweißen in einem Raum mit circa 1000 Personen sind“.
Während sich in Sachen Sexismus seit MeToo die gesamtgesellschaftliche Sensibilität wohl etwas geschärft hat, wird Rassismus nach wie vor oft erst dann als solcher erkannt und benannt, wenn Asylantenheime angezündet werden oder Nazis eine nichtweiße Person „krankenhausreif prügeln“. Hier leistet Wenzel auf unprätentiöse Weise einen wichtigen Beitrag zur Debatte, indem sie „rechten Terror“ weniger mit konkreten Übergriffen als mit einer omnipräsenten Angst verknüpft – etwa, wenn an einem Brandenburger Badesee vier Nazis auftauchen und die übrigen Badegäste sich nach und nach verdrücken. En passant wird zudem die diskriminierende Wirkung „positiver“ Rassismen thematisiert: Wie etwa der eigenen Großmutter vermitteln, dass die Bezeichnung „meine Schokokrümel“ für ihre Enkel zwar liebevoll gemeint sein mag, stets jedoch auch eine Exotisierung mittransportiert?
Dabei ist äußerst angenehm, dass die Erzählerin keinerlei moralische Überlegenheit für sich beansprucht, sondern immer wieder auch ihre eigenen Vorurteile und Privilegien reflektiert. Mitunter geht sie dabei recht hart mit sich ins Gericht: Nachdem sie mehrere Seiten lang von ihren positiven Erfahrungen mit der schwarzen Community in New York City geschwärmt hat, unterstellt ihr gegen Ende des Buches die anonyme Stimme, „eine Touristin dieser auf Schmerz gewachsenen Blackness“ gewesen zu sein – ob dieser Vorwurf von außen an sie herangetragen wird oder aus ihrem inneren Gewissen spricht, bleibt offen, und hallt dadurch umso länger nach.
Ein klassischer „Bildungsroman“ ist dieses in Schleifen und Sprüngen erzählte Debüt ganz sicher nicht. Dennoch lässt sich eine übergreifende Bewegung im Text erkennen, eine Entwicklung der Protagonistin im Spannungsfeld individueller und gesellschaftlicher Parameter, die man gerne mit nachvollzieht – gerade weil sie nicht durchweg als Sympathieträgerin fungiert, sondern voller Widersprüche steckt. All dies aus der Feder einer schwarzen, feministischen, queeren, ostdeutschen und literarisch eigenwilligen Stimme, von der wir hoffentlich – auf der Bühne sowie zwischen zwei Buchdeckeln – in Zukunft noch mehr hören, sehen und lesen werden.

1000 Serpentinen Angst
von Olivia Wenzel
Hardcover, 352 Seiten, 21 €,
S. Fischer Verlag, Frankfurt/Main