Nell Zink: Virginia
Buch
Lesbisch, schwul oder hetero, weiß oder schwarz: Nell Zink jongliert in ihrem zweiten Buch „Virginia“ mit Selbstbezeichnungen und Fremdzuschreibungen – und tritt dabei bewusst in jedes nur denkbare Fettnäpfchen. Ein sehr amerikanischer Roman, der in den Sechzigerjahren spielt, in die die Autorin (Jahrgang 1964) hineingeboren wurde. Michael Sollorz über Zinks fantasievolle und leicht verrückte Versuchsanordnung.
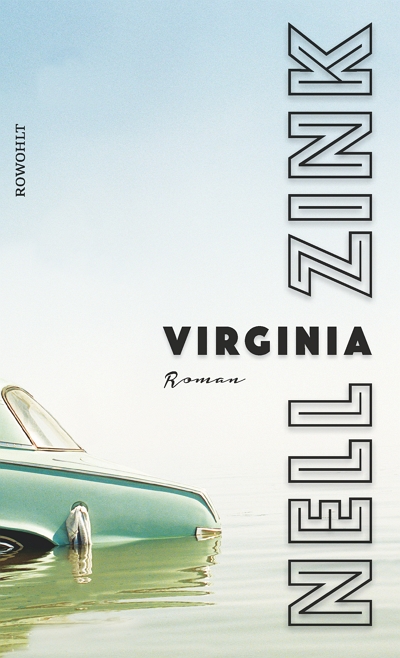
Anything Goes
von Michael Sollorz
Die Geschichte, die „Virginia“ erzählt, beginnt in den 60Jahren des vergangenen Jahrhunderts, jener sagenhaften „Zeit vor Psychologen und Therapien“, von Vietnamkrieg, Rassentrennung und sexueller Prüderie. Kaum zarte Vierzehn, beginnt Peggy Vallaincourt zu ahnen, dass ihr Mädchen gefallen. Eines Nachmittags wirft sie sich für den besonderen Anlass ihres ersten gesellschaftlichen Auftritts in Schale. „Abgeschnittene Latzhosen waren in Ordnung für die Schildkrötenjagd im Wald, aber beim Debütantinnenball wollte Peggy hübsch sein. Am Ende war sie so schön, dass es ihr den Atem verschlug. Sie stand in Slip und Seidenstrümpfen vor dem Ganzkörperspiegel im Ankleideraum für Frauen des Jefferson Hotels und verspürte ein fast überwältigendes Verlangen zu masturbieren.“ Unter diesen Umständen liegt es nahe, dass sie sich für die Zeit nach der Schule ein reines Mädchencollege aussucht, Stillwater, ein Kaff im Nirgendwo. „Sie stellte die Gleichung aus der Kindheit, Mädchen zu mögen bedeute ein Mann zu sein, nicht in Frage, und in schwarzen Chinos und schwarzem Rundhalspullover fand sie sich hart, smart und einschüchternd. Sie sah bezaubernd aus.“
Das findet denn auch Lee Fleming, künftiger Erbe riesenhaften Grundbesitzes und als solcher gesellschaftlich unantastbar. Er residiert am Stillwater-College als Lyrik-Dozent und ist selbst ein schwuler Dichterstar, was ihn nicht hindert, die knabenhafte Peggy zu begehren. „Er wollte die bedürftig starrenden Blicke vorher und die dankbar ehrfürchtigen Tränen nachher, als wäre jeder Orgasmus eine Begnadigung, ein Aufschub des Todesurteils.“ Doch da ist ein Haken. „Er wollte es nur nicht immer.“ So kommt es, wie es kommen muss. Zwar heiraten die beiden, doch bald stellt Lee lieber wieder Jünglingen nach und empfängt seine illustren Dichterkollegen in ihrem Haus am See. Weit davon entfernt, für ihren zynisch-geistreichen Gatten als ebenbürtige Partnerin zu gelten, rutscht Peggy unversehens in ihre neue Rolle, die Mutterschaft. „Ihr war es bestimmt, das Baby zu präsentieren und Lob für ihre Arbeit zu akzeptieren, als sei sie ein Wesen aus einer etwas niedrigeren sozialen Schicht – was sie auch war. Eine Frau.“

Nell Zink – Foto: Fred Filkorn
Nell Zinks Roman steckt voller Überraschungen und lässt sich lesen als leicht verrückte Versuchsanordnung über Fragen alldessen, was wir Identität nennen. Wer es politisch korrekt braucht, lässt besser gleich die Finger von dem Buch. Andern wird es ein Grinsen ins Gesicht zaubern, voran den Verehrern solcher Kaliber wie John Updike, Kurt Vonnegut oder Philip Roth. Wie haben uns die großen Toten zum Lachen gebracht, Verneigung! Über dieses kostbare satirische Talent verfügt auch Nell Zink. Unerschrocken treibt sie ihren Schabernack mit Geschlecht, Rollenbild, sexueller Orientierung und wie die Chimären sonst noch heißen, mit denen wir uns ewig herumplagen. Sie beherrscht das feine Florett der Süffisanz, schwingt aber gerne auch die Keule des Kalauers. Selbst Angelegenheiten ethnischer Zugehörigkeit landen auf ihrer flotten Schippe.
Nach einer weiteren Niederkunft erträgt Peggy das Leben neben Lee nicht länger und verlässt ihn, heimlich und mit Baby zwo, einer Tochter. Nun wird sie landesweit gesucht als Kindesentführerin, taucht unter und erlangt mit einer gestohlenen Geburtsurkunde eine neue Identität. Egal, wie blond – du bist, was in deinem Ausweis steht! Aus der sittsamen Professorengattin wird über Nacht Meg Brown, alleinerziehende Frau aus der schwarzen Unterschicht. „Mit einigem Bedauern wurde ihr klar, dass sie sich einer Rasse angeschlossen hatte, mit der sie praktisch nie in Kontakt gekommen war.“ Unerkannt lebt sie mit ihrem gleichfalls blonden Töchterchen in beklemmender Armut, aufrecht gehalten von dem Traum, Schriftstellerin zu werden und eines Tages nach New York zu gehen. Doch mit der Kunst ist es auch nicht so leicht. „Sie starrte niedergeschlagen auf ihre Schreibmaschine und schenkte sich einen Drink ein.“ Die prekäre Lage bessert sich erst Jahre später, als ihr Lomax begegnet, der „Mittelschicht-Indianer“ mit Berufsunfähigkeitsrente. Sie reüssiert im Drogenhandel, zunächst mit gesammelten Pilzen, später dem berühmten weißen Pulver, und eine Knarre hat sie plötzlich gleichfalls unterm Bett. Niemand ahnt ihre geheime Identität. Mit den anderen Frauen in der Neubausiedlung für sozial Bedürftige versteht sich Meg gut. „Zwei von ihnen hatten eine feministische Selbsterfahrungsgruppe gegründet. Sie diskutierten monatelang, ob sie nicht mal eine schwarze Frau dazu bitten sollten, und sie meinten damit Meg. Die Neugier siegte, und sie luden sie ein.“
Was denken andere Menschen von uns? Ist es nicht ebenfalls – ob wir wollen oder nicht – Teil dessen, was der Begriff Identität nur notdürftig fasst? Was sehen sie, wenn sie uns anschauen? Werden wir verstanden? Sind wir anerkannt, haben wir in ihren Augen einen Wert? Durch häufige Wechsel von Figur und Perspektive optimiert Nell Zink ihr Material und kullert uns immer wieder mal eine andere Farbe hin. Zum Beispiel Byrdie, Megs bei seinem Vater zurückgelassener Sohn, der inzwischen schon zur Schule geht. Feierlich erklärt er auf Nachfrage seinem Lehrer: „Meine Mutter war eine gottesfürchtige Christin, so wie mein Vater.“ Was wie ein schlechter Witz klingt, beweist nicht erst in der sogenannten Fake-News-Ära doch wieder nur die alte Regel: je dreister eine Lüge und ihre schamlose Wiederholung, desto gläubiger geben wir uns schließlich hin. Was der Junge seinem Lehrer sagt, ist natürlich Quatsch, doch zugleich „der Kern der Erklärung, die er für sich gefunden hatte. Er konnte sich nicht vorstellen, dass irgendjemand es länger als fünf Tage mit seinem Vater aushielt, und sie war zehn Jahre geblieben. (…) In seinen weitschweifigeren, nicht auf ihren Kern reduzierten Überlegungen hielt er sie für eine unwürdige Fotze. Denn welches Monster verlässt den kleinen Sohn und schreibt nicht mal eine Postkarte?“
Times are changing. Wechsel zu Lee ans Stillwater-College. Plötzlich gibt es dort ein Russ-Meyer-Filmfestival, „von einer kleinen Maoistin organisiert, die immer die Rote Bibel mit sich herumtrug.“ Der alternde schwule Dozent fühlt sich übergangen und abgehängt. „Sein ganzes Leben hatte er sich als Rebell gegen eine Herrschaftsform in Stellung gebracht, die in Frage zu stellen niemanden mehr interessierte.“ Unwillkürlich denkt der Rezensent an die tapferen Urgestalten der linken Homo-Bewegung in der BRD. Eine von ihnen, der Filmwissenschaftler und Ausstellungsmacher Wolfgang Theiß, brachte es vermutlich auf den Punkt, als er kürzlich in Jochen Hicks historischen Dokumentarfilm „Mein wunderbares West-Berlin“ sinngemäß feststellte, eine Befreiung hätte ja am Ende nicht die Bewegung erreicht, sondern der Kapitalismus.
Lee ist völlig überfordert, als in den 80ern plötzlich die Seuche ausbricht, und er bemerkt bestürzt: „… der Körper macht deutlich, wie wenig wir uns selbst gehören.“ Der schöne Satz enthält die Einsicht, was Identität am Ende ist. Ein schwankendes Geflecht aus Konstruktionen, Umständen geschuldet, morgen schon obsolet. Das heißt aber auch: Jeden Tag kann Veränderung geschehen! Sogar unsere Heldin kriegt noch die Kurve, ihr zweites Coming-out. „Du Idiotin, dachte Meg. Du bist eine femme!“ Gleich nächsten Samstag marschiert sie los, „im enganliegenden Strickkleid mit Strumpfhose“, und schon taucht die Richtige auf, eine leckere junge Bilderbuch-Butch, überdies Dozentin für Frauenforschung in der Traumstadt New York. „’Ich werde dich jetzt vögeln‘, teilte sie Meg mit, wobei sie sie zugleich küsste und mit einer Kombination aus Tangoschritt und Ringergriff auf den Boden zwischen zwei Reihen Sojabohnen warf.“
Nell Zink ist Jahrgang 1964. Sie debütierte sehr erfolgreich erst im Herbst 2014. „Virginia“ ist ihr zweiter Roman, der dritte erschien bei Rowohlt bereits im vergangenen Jahr unter dem Titel „Nikotin“. Seit 6 Jahren lebt die Amerikanerin in Bad Belzig im Süden Berlins, einst geografischer Mittelpunkt der DDR, tiefe brandenburgische Provinz. Sicherlich dient es der Reklame für ihre Person, indem es eine willkommene Absonderlichkeit darstellt. Denn ein Vorschuss von 425.000 Dollar schickt ein Buch in jene Zone, wo der Bestseller gelingen muss. Entsprechend wird großes Geraune in Gang gesetzt. Nell Zink, die Spätberufene, ein leuchtender neuer Stern am Himmel der Erzählkunst? Die Literaturindustrie braucht dergleichen, das Medium Buch verliert an Bedeutung, frische Leser müssen dringend gewonnen werden. Und so ist „Virginia“ neben allem eben auch ein kalkuliertes Produkt. Frech wider ideologischen Beton, ein bisschen böse, aber nicht zu sehr. Erst kürzlich vertraute Nell Zink einem Journalisten von der Süddeutschen Zeitung bei seinem Besuch in Bad Belzig über die Entstehung ihres Erstlings an, es sei ihr darum gegangen „zu zeigen, dass mir klar ist, was der Markt will. Ich habe die ersten dreißig Seiten in vier Tagen geschrieben und nie mehr angeschaut. Ich weiß, was ich tue. Aber ich selbst lese lieber Adalbert Stifter und Robert Walser.“
Folgerichtig gehorcht die Autorin zum Schluss den Gesetzen der Soap, alle Konflikte lösen sich märchenhaft auf, immerhin dermaßen überzogen, dass die parodistische Absicht unverkennbar bleibt. Denn wir wissen es ja alle: unsere Welt tickt leider anders. Das Ende der Geschichte wird hier selbstverständlich nicht verraten. Selber lesen, gute Unterhaltung!

Virginia
von Nell Zink
Aus dem Englischen von Michael Kellner
Gebunden, 320 Seiten, 22 €,
Rowohlt
