Michael Roes: Der Traum vom Fremden
Buch
Ostafrika 1883: Arthur Rimbaud, der große Poet der Dritten Französischen Republik, hat dem Dichterleben abgeschworen und arbeitet als Kaffee- und Waffenhändler in der legendären Stadt Harar. Als sein Geschäftspartner Sotiro von einer Erkundungsreise im Ogaden nicht mehr zurückkehrt, startet Rimbaud eine Rettungsmission – und dringt in die noch unerforschte Wildnis vor, wo ihn unerwartet die Poesie einholt. Als Grundlage für seinen neuen Roman „Der Traum vom Fremden“ diente Michael Roes ein authentischer Bericht, den Rimbaud 1883 über den Ogaden verfasste. Reflexionen über das Reisen, das Dasein und das Schreiben wechseln sich ab mit Erinnerungen an die Amour fou mit Paul Verlaine, Rimbauds Zeit bei der Fremdenlegion und seinen Neuanfang in Afrika. Gabriel Wolkenfeld über ein fiebertraumartiges Buch voller Geistesblitze.
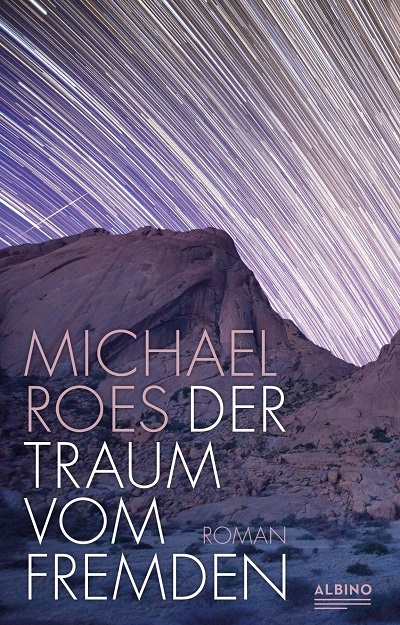
Eruptionen, Brandungen, Böen
Im Jahre 1883 begibt sich Arthur Rimbaud, einstiges Wunderkind der Poesie, auf eine Expedition in den somalisch-abessinischen Ogaden. Er, der dem Schreiben doch eigentlich abgeschworen hat, soll einen Bericht für die Geographische Gesellschaft verfassen. Ausgerechnet er, der dem Wort misstraut und die Lyrik dem Tod gleichsetzt, verlangt sich ab, die in dem nahezu unerschlossenen Gebiet lebenden Völkerschaften zu studieren, ihre Bräuche und Sitten, aber auch die Natur, deren Pflanzen und Tiere größtenteils noch unbenannt sind. Den Aussteiger lockt die Vorstellung, sich im afrikanischen Niemandsland losgelöst von den Fesseln der Gesellschaft bewegen zu können. Doch zahlt er einen hohen Preis: Die Reise nämlich stellt eine Gefahr für Leib und Seele dar. Dort, wo Rimbaud zum Fremden wird, ohne Biografie, die es erlaubt, sich als Teil der Gemeinschaft zu verstehen, ist er auf sich selbst zurückgeworfen. Er wird zum Europäer. Er wird, ohne einen Vers zu schreiben, noch einmal zum Dichter.
Wir begleiten Rimbaud von Harar, einem Zentrum des Islams, auf seinem Weg in den Süden eines Reiches, in welches kaum je ein Europäer seinen Fuß gesetzt hat. Eigentlich Werkstattleiter eines Handelskontors, führt Rimbaud nun einen Trupp an, dem sich entgegen seines Wunsches Kaufleute und christliche Missionare anschließen, die einen Kolonialisten, Entsandte des Kapitalismus, die die Ware und ihren wirtschaftlichen Vorteil über den Menschen stellen, die anderen Anhänger eines Glaubens, der jegliche Sinnlichkeit negiert. Rimbaud fühlt sich belästigt. Sein eigentlicher Auftrag indes besteht darin, einen Kollegen – fast einen Freund, heißt es – aus der Gefangenschaft eines Stammeshäuptlings zu befreien, der als besonders blutrünstig gilt. So aufregend dieses Unterfangen anmutet, rückt es doch bald in den Hintergrund. Denn was als einigermaßen sachlicher Bericht einer Reise beginnt, weicht bald den Bildern eines Fiebertraums. Die Tagebuchform, die Roes für seinen Roman wählt, erzeugt eine sehr enge Bindung des Lesers an den Protagonisten. Über Rimbaud blickt denn auch niemand hinaus. Alle anderen Figuren bleiben schemenhaft, Schatten, Irrlichter, Dämonen. Eingeführt werden sie oft nachträglich, weshalb man sich selbst durch dieses Buch wie durch einen Traum bewegt.

Michael Roes – Foto: privat
Irritation ist also Teil des Konzepts. Nähe und Distanz halten sich auch auf Figurenebene die Waage. Ein Beispiel: Für ein paar Alltagsgegenstände und ein wenig Schmuck kauft Rimbaud einer unwirschen Witwe ihren jungen Leibeigenen ab, offiziell um diesen in seinen Dienst zu stellen, eher aber aus Mitleid und Sympathie. Roes erliegt nicht der Versuchung, seine Figuren bis ins Detail auszugestalten: Es ist der Traum vom Fremden, der erzählt wird, der Traum vom Fremden, dem anzunähern man sich nicht wagt. Diese gewisse Unschärfe erlaubt es, alles Mögliche in den im Stillen Begehrten hineinzuprojizieren, aber auch das Verhältnis von Dienstheeren und Diener umzukehren: Rimbaud wird zum Schüler eines kaum aus der Sklaverei befreiten Jungen.
Inspiriert von einem Bericht, den Rimbaud tatsächlich über seinen Aufenthalt im Ogaden verfasst hat, lässt Roes seinen (Anti-)Helden sechs Hefte vollschreiben. Sie sind gespickt mit zum Teil wild durcheinanderfliegenden Gedanken, Geistesblitze durchzucken den Text, aber auch von lapidaren Kommentaren wimmelt es, Bemerkungen zu alltäglichen Beobachtungen sowie Analysen der menschlichen Natur, Erinnerungen an die strenge Mutter, Päpstin genannt, und lose Kindheitsszenen, die kein rechtes Bild ergeben, doch zwischendrin immer wieder: Sätze von seltener Strahlkraft, zum Exzerpieren schön. Neben Rimbaud tritt die Natur als zweite Protagonistin auf, spröde und scheinbar jederzeit zu einer gewaltsamen Übernahme des Körpers bereit. Sie lässt eine Hundertschar namenloser Insekten auftreten, wilde Tiere, alte Bekannte oder Exoten der Wüste, die der Autor, der kein Autor mehr sein will, in seinem Tagebuch beschreibt. In der kargen Landschaft Ostafrikas, fernab sanitärer Anlagen und einer übergeschnappten Sonne ausgesetzt, zeigt sich der Mensch als Raubtier. Dies gilt bezeichnenderweise für Einheimische und Europäer gleichermaßen: Menschen bekriegen sich aus scheinbar nichtigen Anlässen. Die Abschaffung der Sklaverei durch die ägyptischen Besatzer hat keineswegs zur Beendigung des Menschenhandels geführt. Strukturen von Macht und Abhängigkeit bleiben erhalten. Aus Lust tötet der Europäer wilde Tiere, die Einheimischen fügen sich mit Peitschen aus Nilpferdhaut tiefe Wunden zu. Als Strafe für einen Diebstahl werden Gliedmaßen abgeschnitten.
Gerade dieses raue Umfeld regt den Ex-Dichter immer wieder zu sprachphilosophischen Überlegungen an. Rimbaud scheint zerstritten mit der Sprache. Er nimmt ihr übel, dass auch sie ihre Grenzen hat, ja, dass sie unfähig ist, alles abzubilden. „Gott weiß: ich habe es versucht, mich mit Eruptionen, Brandungen, Brücken und Böen den Eindrucksfetzen zu nähern. Kaum je ist es mir gelungen, die wirklichen Farben und Töne einzufangen. Annäherungen, ja, Skizzen, Umkreisungen: am Ende aber doch nur Abfälle Splitter Schutt.“ Aus der Rolle des Ethnologen ausbrechend, hinterfragt er, warum den Pflanzen und Insekten Namen gegeben werden, zumal sie doch durch die Bezeichnung nicht an Sinn gewinnen. An anderer Stelle meint Roes‘ Protagonist die Stimme seines Gesprächspartners zu riechen. Schließlich vermengt er Sprechen und Schweigen. In einem Brief an seinen Lehrer schrieb der 16-jährige Arthur Rimbaud, er arbeite daran, Seher zu werden. Es gehe ihm darum, durch die Verwirrung aller Sinne im Unbekannten anzukommen. Hier, so scheint es, in diesem Roman, 130 Jahre nach seinem Tod, ist ihm das gelungen.

Der Traum vom Fremden
von Michael Roes
Gebunden mit Schutzumlag, 230 Seiten, 22,00 €,
Albino Verlag
