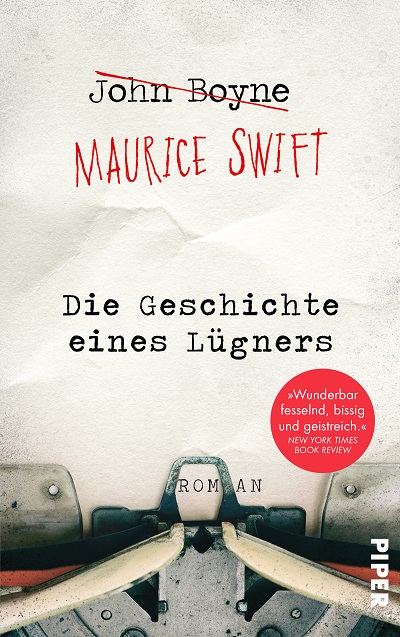John Boyne: Die Geschichte eines Lügners
Buch
Der Schriftsteller Maurice Swift ist ein brillanter Erzähler, aber ihm fehlen die Geschichten. In Westberlin trifft er sein großes Idol Erich Ackermann, und der preisgekrönte Autor verfällt tatsächlich seinem Charme. Als Swift ihm auf Lesereise durch Europa begleitet, weiht ihn Ackermann sogar in sein Geheimnis ein. Die Geschichte, die Maurice daraus entwickelt, lässt ihn zum Star der Literaturszene werden – und führt zu Ackermanns Karriereende. „Die Geschichte eines Lügners“ von John Boyne ist erst Komödie, dann Drama und schließlich komödiantischer Krimi. Matthias Frings hat sich von der Verve des Schelmenromans mitreißen lassen.
Der bildschöne Parasit
von Matthias Frings
Oh, ist das bös. Ist das dreist und schamlos, herrlich niederträchtig, hinterlistig und amoralisch! Mitten in den medialen Aufwallungen des uns allseits umgebenden Frömmlertums gibt sich hier jemand ungehemmt den Wonnen der Charakterlosigkeit hin. In Zeiten, wo einer Politikerin die Fähigkeit zur Kanzlerin abgesprochen wird, nur weil sie in einem politischen Pamphlet nicht so skrupulös verfahren ist wie bei einer Habilitation, müsste die Hauptfigur des neuen Romans von John Boyne zur Strafe mindestens gepfählt, gestreckt und gevierteilt werden, so empörend sind seine Verfehlungen und Missetaten.
Doch halt: John Boyne? Sein Name steht zwar auf dem Buchcover, wurde aber rot durchgestrichen und durch „Maurice Swift“ ersetzt. Wer hat denn nun „Die Geschichte eines Lügners“ geschrieben? Wer ist hier der Lügner? Und darum dreht sich alles in diesem unverschämt unkorrekten Buch: Was genau bedeutet Autorenschaft? Ab wann wird Inspiration zum Diebstahl? Wie viel Faktizität darf jemand verwenden, um immer noch von einem „Roman“ sprechen zu können? Wo wird die Bezeichnung Autofiktion, womit die grassierende Ideenlosigkeit sich gerne tarnt, schlicht zum Tagebuch, und meint das Kulturmodewort „Überschreibung“ so viel mehr als „keine eigene Idee“? Wenn jemand Geschichten aufschreibt, die er von Menschen gehört hat, die sie wiederum von anderen Menschen gehört haben – wer ist dann der Urheber? Kann jemand überhaupt eine Geschichte „besitzen“?
Von solchen Fragen, die uns (und die Gerichte) als Sampling in den Bereichen Musik, Literatur, bildende Kunst, Film usw. zunehmend beschäftigen, handelt Boynes Roman. Es sind ernste Fragen, die für KünstlerInnen auch eine existenzielle Dimension beinhalten, die von ihm jedoch nicht in Bedenkenträgerpose einer kulturkritischen Erörterung unterzogen werden. Nein, dies ist das saftige, effektreiche, lustige und sehr, sehr listige Buch eines geborenen Geschichtenerzählers.

John Boyne – Foto: Chris Close
Der erste Romandiebstahl wird stilvoll im Berliner Hotel Savoy eingefädelt. Erich Ackermann, ein Großschriftsteller deutscher Herkunft, der im Exil in England zu literarischen Ehren kam, ist wegen einer Lesung hier abgestiegen. Als wäre er halb einem Roman von Hans Pleschinski und halb einem Werk von Alain Claude Sulzer entwendet worden, bedient den Romancier alter Schule ein bildschöner Kellner mit literarischen Ambitionen, besagter Maurice Swift. Nicht nur seine selbstverfassten Kurzgeschichten sind vielversprechend. Ackermann steht sogleich hilflos verliebt in Flammen und bietet ihm eine Stelle als Privatsekretär an. So beginnt eine Reise zu zweit durch den internationalen Literaturzirkus, von Preisverleihung zu Literaturfestival, Interviewmarathon zu Podiumsdiskussion.
Hier kann John Boyne, der den Welterfolg „Der Junge mit dem gestreiften Pyjama“ schrieb, natürlich tief in sein Erfahrungsschatzkästlein greifen und die schillerndsten Fundstücke hervorzaubern. Hochamüsant, die mit vergifteter Feder geschriebenen Gastauftritte von Paul Auster und Siri Hustvedt. Sie werden nicht beim Namen genannt, sind aber umstandslos zu erkennen. Und hinter dem nicht unbegabten, leidlich erfolgreichen, aber äußerst schwulen Schriftsteller Dash Hardy darf man getrost Edmund White vermuten, obwohl (oder gerade weil) im Roman en passant auch von einem Edmund White die Rede ist. Das Porträt dieses sexuellen Vielfraßes, eine nicht enden wollende Ejakulation in puncto Jungs, Klatsch und übler Nachrede, ein vulgärer Dampfplauderer, aber ursympathisch in seiner gnadenlosen Selbsterkenntnis, gehört zu den Glanzstücken des Romans.
Derweil erwartet der beim Namen genannte – weil tote – Gore Vidal in seiner Villa „La Rondinaia“ in Ravello den befreundeten Dash samt Maurice Swift, den er inzwischen von Ackermann übernommen hat. Mit welch exquisiter Bosheit, für die längst verloren geglaubte Begriffe wie „maliziös“ und „Sottise“ wieder aus der Versenkung geholt werden müssten, er diese Amour fou seziert, sucht ihresgleichen. Vidal, dieses hochintelligente und mit allen Wassern gewaschene Schandmaul, diese Edel-Skandalnudel, erkennt sofort einen literarischen Wegelagerer, wenn er ihn sieht, und ist der einzige in diesem Roman, der Maurices nicht unbeträchtlichen Reizen widersteht. Vidal ist selbst zu abgefeimt und besitzt zu viel Menschenkenntnis, um ihm auf den Leim zu gehen und das Odeur eines Straßenjungen nicht zu erschnüffeln.
In der Welt der Literatur hat Maurice Swift es allerdings weit gebracht. Nachdem der gutgläubige Ackerman ihm an intimen Abenden gebeichtet hat, wie er, der Jude, in Jugendjahren einen anderen Juden der Gestapo auslieferte, nur weil der seine Liebe nicht erwiderte, schnappt die Falle zu: Mit kaum veränderten Namen macht Swift diesen Sündenfall zum Thema seines ersten „Romans“. Ackermann hatte ihm Zugang zu seinem literarischen Netzwerk verschafft, und so sitzt paradoxerweise der Betrüger Swift auf dem hohen moralischen Ross, während der arme Ackermann vom Feuilleton in Schande davongejagt wird.
Talent haben, aber kein Thema, schreiben können, aber nichts zu sagen zu haben, das ist Swifts großes Problem, für das er im weiteren Verlauf des Romans so manch kreative Lösungen bis hin zum Mord findet. Und der schöne Parasit, schämt er sich? Keineswegs. Offensiv verkündet er, dass Dichter anders als Politiker ihre Quellen nicht offenlegen müssten und ruhig aus fremden Brunnen Inspiration schlürfen dürften. Die Erlebnisse und Erzählungen anderer auszuleihen, osmotisch einzuatmen und weiterzudenken gehöre seit jeher zum literarischen Schreiben. (Die letzten Sätze sind übrigens fast wörtlich der Rezension von Martin Halter in der FAZ entnommen, wie auch diverse weitere Bruchstücke der vorliegenden Besprechung nicht aus der Feder ihres vorgeblichen Autors Matthias Frings stammen …)
Mehrfach setzt John Boyne in seinem Schelmenroman ein Mittel ein, für das er bekannt ist: Mit unvorhergesehenen Wendungen springt er jeweils Jahrzehnte nach vorn. Ausgiebig nutzt er dieses Stilmittel übrigens in seinem Roman „Cyril Avery“, eine furios komponierte schwule Biographie über siebzig Jahre hinweg, irgendwo zwischen Dickens und John Irving, die Liebhabern saftiger Schmöker sehr ans Herz zu legen ist. Was den Roman über Maurice Swift betrifft, wechseln in ihm nicht nur die Jahrzehnte, sondern auch die Erzählperspektiven. Aus Komödie wird Drama und daraus wiederum ein komödiantischer Krimi.
In dieser mit Verve erzählten Geschichte von Täuschung, Verführung und verzweifeltem Ehrgeiz versteckt sich ein in der Literatur selten verwendetes Motiv, das Porträt eines Menschen, der anderen Menschen so gar nichts abgewinnen kann, der sie einfach nicht braucht. „Ehrlich gesagt mag ich Frauen nicht besonders. Was nicht heißen soll, dass ich ein Frauenhasser bin, verstehen Sie mich da nicht falsch. Männer mag ich auch nicht. Wenn schon, dann bin ich ein Männer-und-Frauen-Hasser (…) Und Sex hat mich nie sonderlich interessiert, auch nicht, als ich jung war. Ich habe nie viel Sinn darin gesehen.“
Schon bemerkenswert bei diesem Hintergrund, mit wie viel Sympathie Boyne den Ehrgeizling Maurice Swift beschreibt. In der „Geschichte eines Lügners“ hat der immer auch etwas von einer Patricia-Highsmith-Figur. Heimlich wünscht man sich beim Lesen, dass er mit seinen Gaunereien vielleicht doch durchkommen möge. Schlussendlich aber, und das ist tröstlich, kennen all diese bösen Geschichten nur einen Sieger: den talentierten Mr. Boyne. Denn der ist als Privatperson, wie er in einem Interview erzählt, auf seinen ganz persönlichen Maurice hereingefallen: einen jungen Autoren, der seine Reize einsetzte, um seiner Karriere zu nutzen. Dem privaten Pech des Autors verdanken wir dieses überaus vergnügliche Buch.

Die Geschichte eines Lügners
von John Boyne
aus dem Englischen von Maria Hummitzsch und Michael Schickenberg
Hardcover mit Schutzumschlag, 432 Seiten, 24,00 €
Piper Verlag