Jeanette Winterson: Frankissstein
Buch
Seit ihrem erfolgreichen Debüt „Orangen sind nicht die einzige Frucht“ im Jahr 1985 kreist Jeannette Wintersons literarische Fantasie beharrlich um Fragen nach den Grenzen von Körperlichkeit, des Vorstellungsvermögens und der sexuellen Identität. Insofern ist es kein Wunder, dass die komplexe Thematik von Mary Shelleys Roman „Frankenstein“ eines Tages in ihren Blick geriet. In einer Zeit, in der Geschlechtsangleichungen längst Normalität geworden sind und mit künstlicher Intelligenz experimentiert wird, erzählt Winterson die Liebesgeschichte von Ry Shelley und Victor Stein. Anja Kümmel hat sie gelesen.
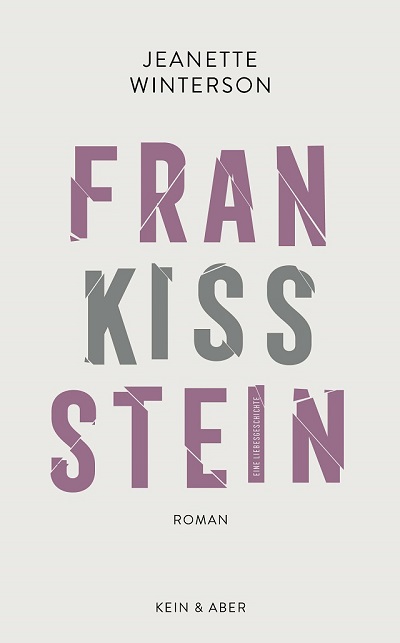
Benennen bedeutet Macht
von Anja Kümmel
„Was wir erfinden, können wir nicht unerfunden machen.“ Jeanette Winterson legt diesen Satz der 19-jährigen „Frankenstein“-Schöpferin Mary Shelley in den Mund – und bezieht sich damit zunächst auf die Weberaufstände in England um 1816: beunruhigende Nachrichten aus der Heimat, die Mary und Percy Shelley auf ihren Reisen durch die Schweiz, Frankreich und Italien erreichen. Während in den großen Industriestädten erboste Ludditen die neu eingesetzten mechanischen Webstühle zerstören, wirft Mary einen abgeklärt-prophetischen Blick in die Zukunft: „Der Marsch der Maschinen ist unaufhaltbar. Die Büchse ist geöffnet.“
In „Frankissstein“, Wintersons Update der berühmten Monster-Erzählung (das übrigens weit weniger frivol daherkommt, als der Titel vermuten lässt), spinnt die britische Autorin den roten Faden der einmal geöffneten „Büchse der Pandora“ gekonnt durch mehrere Zeitebenen, von 1816 bis in die nahe Zukunft. Der zweite Hauptstrang des Romans spielt in einer Post-Brexit-Ära, zwischen Tech-Konferenzen und KI-Forschungslaboren, in denen Themen wie Sexbots, Kryogenik und smarte Prothesen heiß diskutiert werden. Was würde sich mehr als Verbindungsglied zwischen den Zeiten anbieten als Frankensteins Geschöpf, „die erste nicht menschliche Intelligenz“? Doch kommt die Dualität zwischen Schöpfer und Geschöpf noch auf einer weiteren Bedeutungsebene zum Tragen: Auch Viktor Frankenstein ist schließlich die Erfindung eines Geistes – was, wenn sich der (fiktive) Schöpfer ebenso verselbständigt wie seine (fiktive) Kreatur?

Jeanette Winterson – Foto: Sam Churchill
Virtuos bespielt Winterson das Motiv der Doppel- und Wiedergänger, der über Raum, Zeit und Geschlechtergrenzen hinweg fließenden Identitäten, die in teils unerwarteten Konstellationen wieder zusammenfinden. Und, wie es von der lesbischen Kultautorin („Orangen sind nicht die einzige Frucht“, „Auf den Körper geschrieben“) nicht anders zu erwarten ist, werden weibliche Perspektiven, queere Körper und queere Erfahrungen dabei ganz zentral mitgedacht. Ob Mary Shelley in jenem verregneten Sommer am Genfer See vor den chauvinistischen Dichtern Percy Shelley, Lord Byron und Doktor Polidori tatsächlich feministische Reden schwang, ist zwar nicht überliefert – unwahrscheinlich ist es zumindest nicht, bedenkt man, dass ihre Mutter die Aktivistin Mary Wollstonecraft war (u.a. Autorin der Streitschrift „Eine Verteidigung der Rechte der Frau“).
In der nahen Zukunft begegnen wir Mary Shelley in Gestalt des nicht-binären, transmaskulinen Arztes Dr. Ry Shelley wieder – zwar in einem unvermuteten Körper, doch scheint der wache, kritische Geist 200 Jahre locker überdauert zu haben: Auch Ry beobachtet sein Umfeld genau und stellt gerne mal die ein oder andere unbequeme Frage. Nicht zuletzt seinem Lover, dem charismatischen K.I.-Pionier Victor Stein, dessen größter Traum darin besteht, den menschlichen Geist auf ein nicht fleischliches Substrat zu transferieren und damit quasi Unsterblichkeit zu erlangen. Als Echo aus einem fernen Früher klingt Marys Verteidigung ihres Helden herüber: „Mein Schöpfer ist kein Verrückter, sondern ein Visionär.“ Übertragen ins Jetzt, denkt man unweigerlich an Elon Musk, Ray Kurzweil & Co. Während sich letztere gern als wohltätige Retter der Menschheit inszenieren, lässt Winterson die visionären Vorhaben ihres Victor Stein hin und wieder durchaus genüsslich Richtung Horror abdriften: Unterirdische Bunkeranlagen, kryokonservierte Schädel und abgehackte Hände, die spinnengleich durch die Flure huschen, sorgen für ein leises Grauen, das direkt aus der Ära der viktorianischer Schauerromane herüberzuwehen scheint – ein weiterer Glitch in der Zeit.
Auch Ry interessiert sich für die Möglichkeiten und Grenzen körperlicher Transformation, gehört er doch zu einer kleinen Gruppe von Transgender-Medizinern, die sich zugleich für Transhumanismus begeistern („Wir verstehen das Gefühl, dass jeder Körper der falsche Körper ist.“). Doch vertritt er mit seiner bewusst gewählten Ambivalenz – im englischen Original benutzt er das genderneutrale Pronomen „they“, was in der deutschen Übersetzung leider nicht mit transportiert wird – eine andere Position als der manchmal allzu selbstsichere Victor. Von der vermeintlich „neutralen“ Warte eines heterosexuellen Cis-Mannes aus postuliert dieser, bisweilen erstaunlich naiv, eine Zukunft jenseits von Geschlecht, Hautfarbe, körperlicher Beschränkung, Religion, kultureller Zugehörigkeit etc. Doch das Liebesverhältnis mit Ry bringt nicht nur Victors Gewissheit über seine sexuelle Orientierung ins Wanken, sondern konterkariert auch die Vision einer körperlosen Zukunft mit dem doch sehr physischen Jetzt, in dem Victor es durchaus zu genießen scheint, Sklave seiner eigenen Lust zu sein.
Parallel dazu erzählt Winterson auf plastische und berührende Weise, wie Mary Shelley, geprägt durch ihre Erfahrung, eine Frau im 19. Jahrhundert zu sein, immer wieder mit Verfall und Sterblichkeit konfrontiert wird – mit 22 hat sie bereits drei Kinder verloren, kurze Zeit später stirbt auch ihr Ehemann bei einem Bootsunfall. Ihre Obsession, den Tod zu überwinden, entsteht also keineswegs unter sterilen Laborbedingungen oder gar aus Größenwahn, sondern vielmehr aus einem viszeralen Leiden an sehr realen Bedingungen heraus.
Die queere (Wieder-)Aneignung des Frankenstein-Mythos ist natürlich nicht neu – Susan Stryker hat es Anfang der 1990er Jahre in ihrem brillanten Performance-Essay „My Words to Victor Frankenstein Above the Village of Chamounix“ vorgemacht; mit „Testo Junkie“ hat Paul B. Preciado die Idee der Transition als transgressive Selbst-Technologie ins 21. Jahrhundert überführt. Auch hier ist es übrigens der Tod eines Freundes, der den Beginn von Preciados Selbstexperiment markiert. Anstatt geradewegs „zum Mann zu werden“, geht es Preciado vielmehr darum, durch Eingriffe in vermeintlich „natürliche“ biologische Prozesse „meiner low-tech Identität eine molekulare Prothese hinzuzufügen“.
In „Frankissstein“ greift Winterson diese Idee einer „transsexuellen Selbstoptimierung“ auf und hinterfragt sie zugleich: Während der Tech-Utopist Victor Stein davon schwärmt, wie mutig und zukunftsweisend Ry Shelley sein „Portfolio an Möglichkeiten auf Trab gebracht“ hätte, erleben wir gleichzeitig durch Rys Perspektive, dass er weit mehr ist als ein ikonischer „Vorbote der Zukunft“, den Victor in ihm sehen möchte. Vielmehr präsentiert sich Ry als komplexe Figur mit subjektspezifischen Erfahrungen und einem so konkreten wie ambivalenten Körper, der sich nicht vereinnahmen lässt. Wie Frankensteins Kreatur entzieht er sich letztendlich den Einschreibungen und Definitionen der dominanten Mehrheitsgesellschaft, indem er sich selbst Bedeutung gibt, und – ein in Wintersons Werken stets präsentes Motiv: sich selbst benennt.
Sprache, Macht, Gender, die Essenz des Menschen, die Ethik der Wissenschaft – wie Winterson es schafft, all diese großen Themen in spritzige, nicht selten ziemlich komische Dialoge zu verpacken und in lebendige, sinnliche Szenen einzubetten, ist eine Kunst für sich. Nur an wenigen Stellen ufern die Konversationen aus, und man hat das Gefühl, um jeden Preis auch noch das letzte Argument für oder wider KI aus den Feuilletons der letzten Jahre unterbreitet zu bekommen. Insgesamt jedoch ergibt „Frankissstein“ ein ausgewogenes, harmonisches Ganzes: klug und sexy, melancholisch und witzig, dazu voller unerwarteter Subtexte, die sich oft erst allmählich erschließen. Anders als bei medialen Inszenierungen des Frankenstein-Monsters à la Boris Karloff, schauen bei Wintersons Schöpfung nirgends Nahtstellen und lose Fäden, Schrauben oder Muttern heraus – außer natürlich da, wo der Blick ins Räderwerk zum Programm des Romans gehört.

Frankissstein
von Jeanette Winterson
Aus dem Englischen von Brigitte Walitzek, Michaela Grabinger
Hardcover, 400 Seiten, 24 €,
Kein & Aber
