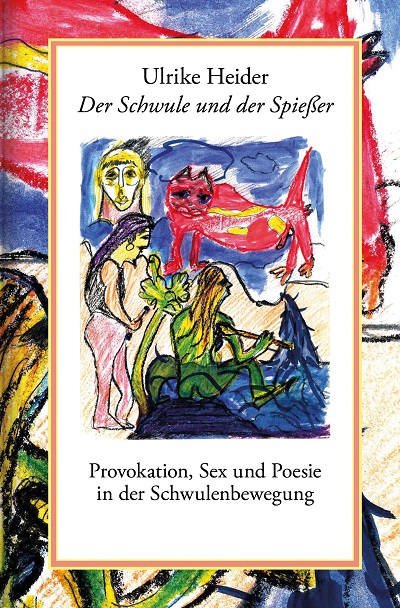Ulrike Heider: Der Schwule und der Spießer
Buch
Als links engagierte Studentin und Hausbesetzerin war die Journalistin Ulrike Heider mit ein paar zornigen jungen Männern befreundet, die 1971 in Frankfurt am Main die Politgruppe RotZSchwul (Rote Zelle Schwul) gründeten. Die beginnende Schwulenbewegung erschien Heider wie eine zweite 68er-Revolte: Provokation, sexueller Hedonismus und spielerische Aktionsformen knüpften ebenso an den Antiautoritarismus von 1968 an wie an die radikale Kritik an der Gesellschaft. Über diese Zeit hat sie nun ein vielstimmiges Erinnerungsbuch geschrieben. Roter Faden dabei ist das provokative Leben und politische Wirken eines engen Freundes, des 1992 an Aids verstorbenen Lyrikers Albert Lörken. Boris von Brauchitsch hat den berührenden Zeitzeuginnenbericht für uns gelesen.
Jungs kommen in die Wurst
Ulrike Heider, Jahrgang 1947, taucht als Zeitzeugin tief in das Frankfurter Lokalkolorit ein und entwirft das sowohl präzise als auch schillernde Bild einer weit zurückliegenden Ära. Ihr Bericht „Der Schwule und der Spießer“ ist so facettenreich und süffig geschrieben, dass man in dieser Form selbst schwulenbewegtes Allgemeingut gern noch einmal liest, zumal es verdichtet und erfreulich subjektiv zugespitzt daherkommt.
Hier tauchen sie alle, die längst etabliert und patiniert ihr Plätzchen in der bundesdeutschen Geschichte haben, noch einmal als streitbare und vitale Typen auf, die die Mainmetropole auch jenseits der Frankfurter Schule zu einem politischen Kulminationsort zwischen sexueller Befreiung und Klassenkampf machten: Günter Amendt und Martin Dannecker, Reimut Reiche und Joschka Fischer, Hans-Peter Hoogen und Volkmar Sigusch, Rosa von Praunheim und Corny Littmann. Im Zentrum aber steht der strahlende, revolutionäre, schwule und vergessene Dichter Albert Lörken, auf dessen Spuren Ulrike Heider gut zehn Jahre nach seinem Tod Jugendfreunde und Weggefährten ausfindig macht und befragt.
Das erste Mal erblickte sie den Philosophie studierenden Bauernsohn nackt am Baggersee, wo er alle Blicke auf sich zog. Bald schon wurden sie enge Freunde, verbrachten die Nächte im Tanzschuppen Aquarius in der Schützenstraße und suchten sich gemeinsam vom Muff ihrer christlichen Erziehung – sie protestantisch, er katholisch – zu befreien, indem sie auf bürgerlichen Partys Zigaretten auf dem Flokati austraten, das Buffet leerfraßen und sich laufstark nach „was zu ficken“ umsahen.
Natürlich gehörte auch der Fummel dazu, die Absage an das Machotum, das Bekenntnis zum „schwulen Feminismus“, die Provokation durch die Persiflage des Femininen, die für bürgerliche Heteros wie für angepasste Homos noch immer „am oberen Ende der Skala homosexueller Peinlichkeit rangierte“, wie Heider treffend bemerkt. „Diese Schwuchtel, die kaum ein Schwuler anziehend fand, wurde jetzt zur Heldin der Emanzipation erhoben.“ Gleichzeitig offenbarte sich nirgends deutlicher die Kluft zwischen politischem Anspruch und erotischer Konvention: „Wir haben alle gelogen, wenn wir gesagt haben, wir haben nichts gegen Tunten“, sagt ein Aktivist. „Keiner ist mit ihnen ins Bett gegangen.“

Ulrike Heider – Foto: privat
Sehr anschaulich schildert Ulrike Heider den sogenannten Tuntenstreit, der zwischen dem Mainstream der Homosexuellen Aktion Westberlin (HAW) und einer Reihe von selbsterklärten „Feministen“ ausgetragen wurde. Was hatte Vorrang, der Kampf gegen das Kapital oder der Kampf gegen das Patriarchat? Während die Tuntenfraktion eine Selbstverwirklichung der Individuen einklagte und eine Lanze für das Anderssein brach, war die HAW-Mehrheit der Ansicht, aufgrund allzu langer Unterdrückung schieße man nun deutlich übers Ziel hinaus, wenn man seine weiblichen Anteile als Karikatur zur Schau stelle. „Frau sein“, so zitiert Heider eine HAW-Streitschrift, „ist kein Fortschritt, auch nicht, wenn Männer es versuchen“. Es wird deutlich, dass das Herz der Autorin nicht unbedingt für die Tunten schlägt, für jene Kerle, die sich, als weibliche Klischees aufgetakelt, bösartig und hysterisch gebärden. „Warum musste“, fragt sie, „wer den Macho ablehnte, zu dessen weiblichem Gegenstück werden? Galt es nicht Schluss zu machen mit Supermännern wie mit Überfrauen?“
Wenn sie Hirschfeld, Freud, Giese oder Dannecker referiert, trudeln manchmal etwas unreflektiert Begrifflichkeiten wie „Päderast“ oder „Sodomie“ umher und wenn sie konstatiert, „Noch in den 1970er Jahren galt es unter Linken als ausgemacht, dass die Mehrheit der Kindesmissbraucher nicht (schwule) Sittenstrolche, sondern prügelnde Eltern seien“, dann klingt das, als handle es sich nicht um eine nach wie vor gültige und durch Statistiken gestützte Tatsache, sondern um die verschrobene und lang überholte Ansicht radikaler Phantasten.
Auch andernorts begegnet Heider der schwulen Szene mit Befremden, etwa wenn sie sich Gedanken über die Faszination von Klappen macht. Warum nur treffen sich Männer in stinkenden Pissoirs, wenn man doch auch entspannt zusammen im Bett liegen könnte? Ist es wirklich das ängstliche Bedürfnis nach Anonymität? Oder sind es die Schuldgefühle und der Selbsthass der Schwulen, die sie in öffentliche Aborte treiben? Oder geht es doch nur um schnellstmögliche und unverbindliche Triebabfuhr? Eine mögliche Antwort gibt sich Heider wenig später selbst: Die Klappe – einst durchaus Zufluchtsort für flüchtigen Sex in Verbots-Zeiten – wird zum schwulen Symbol für radikale Promiskuität, wie sie entsprechend dem Zeitgeist auch von der Frankfurter Schwulengruppe RotZSchwul (Rote Zelle Schwul) gefordert wurde. Derartige Optionen zum Partnerwechsel für die schnelle Nummer waren für männliche Heteros bestenfalls im kostspieligen Bordell vorstellbar.
Dann wieder wartet Heider mit erfrischend skurrilen Geschichten auf, die ihr selbst in der Szene begegnet sind, wie der Erklärung eines Bauern, warum er immer schon ein Mädchen sein wollte: „Auf dem Land nämlich, da seien alle männlichen Tiere potentielles Schlachtvieh. Nur einen Bullen gäbe es im ganzen Dorf und nur wenige Hähne. ‚Jungs sind überflüssig und kommen in die Wurst‘“.
Aus dem edlen, befreiten Hedonismus der Sexrevolte, so Heider, wurde unter amerikanischem Einfluss Mitte der 70er Jahre der Konsum von Macho-Sex schnauzbärtiger Klone, die politische Utopien längst über Bord geworfen hatten. Aus dem inspirierenden Wunsch nach Veränderung wurde ein dumpfes „Weiter so“ und „Mehr davon“, das Anfang der 80er, mit Aids, in Resignation umschlug. Und was vielen Jüngeren als ein aufregender Beginn einer öffentlichen Sichtbarkeit erschien, das Homolulu-Fest 1979, war für Heider ein Abgesang auf die politische Schwulenbewegung. Die Spaßfraktion hatte gesiegt. Doch mit der Entpolitisierung sei aus dem friedensstiftenden Sex der 70er nun ein Hymnus auf Gewalt und Leidenschaft geworden, verkörpert in Filmen wie Fassbinders „Querelle“ (1982) oder – für die Heteros – Sauras „Carmen“ (1983): S/M-Praktiken, gerade noch als faschistoid verpönt, waren nun en vogue und „Sauras Image von der Frau, die wie ein Tier nur dem Instinkt folgt, schien alle aufatmen zu lassen. Endlich war es wieder da, das Ewig-Weibliche, die Mutter-oder-Hure-Alternative, Grundlage des altgewohnten Geschlechterdualismus und seiner Folgen.“
Eindrücklich ruft Heider die ebenso hilflose wie perfide Sensationsberichterstattung über Aids auch in vermeintlich linken Medien wie dem Spiegel in Erinnerung. Jene Seuchen-Hysterie, besonders prominent befeuert von der bayrischen Trias Zehetmaier, Gauweiler und Ratzinger, die von Internierung und Entartung schwadronierten, führte zu teilweise ebenso irrationalen Gegenreaktionen, vornehmlich einer Verharmlosung von Aids durch Autoren wie Dannecker, die eine durch Aids ausgelöste Renaissance von Verfolgung und Selbsthass befürchteten und die Krankheit als Unterdrückungsinstrument eines neuen Moralismus wähnten.
Parallel zum Wandel der Zeiten vollzieht sich der Wandel ihres Freundes Albert vom hoffnungsvollen Philosophiegenie zum ständig klammen Reiseleiter, ein Abstieg, den Ulrike Heider als unmittelbare Folge hemmungslosen Konsums von Drogen und Sex versteht. Und doch wird ihr Blick auf den Freund nie bitter, sondern bleibt stets berührend und zärtlich. Auch dann noch, als Albert in sein für die Autorin „unerwartet hässliches“ Geburtskaff zurückzieht, ins Haus seiner kürzlich verstorbenen Eltern mit vagen und bald enttäuschten Aussichten, Kulturdezernent von Düren zu werden. „Verlasse Frankfurt, das ist deine einzige Rettung“, hatte ihm die Mutter noch in einem ihrer letzten Briefe zugerufen. Er lebte nun in der Gruft seiner Eltern, doch auch in Frankfurt war eine Ära zu Ende gegangen. Zeit, zu neuen Horizonten aufzubrechen. Während Ulrike Heider nach New York übersiedelte, zog es Albert Lörken eben zurück ins 2000-Seelen-Dorf Mariaweiler. Und während Heider ein Überleben in New York gelingt, stirbt Albert in einer Dürener Klinik an den Folgen von Aids.
„Der Schwule und der Spießer“ ist ein Buch, das eine Neugier auf die Phänomene schwulen Daseins offenbart, die auch nach fünfzig Jahren noch nicht erloschen ist. Das kleine Frankfurter Universum, das Ulrike Heider auferstehen lässt, ist voller Wehmut und Sympathie für ihre schwulen Freunde, ohne deren Trost, Humor und Liebe sie selbst diese Zeit weniger unbeschadet überstanden hätte. Es ist eine Verklärung der eigenen Jugend und eine Geschichte vom Verlust der Utopien. Es ist aber vor allem eine Liebeserklärung an ihren Protagonisten wie an die schwule Aufbruchszeit nach der Studentenrevolte, auf die aus Sicht Ulrike Heiders über die Jahre immer dunklere Schatten fallen. Ein lohnendes, ein berührendes Buch.

Der Schwule und der Spießer
Provokation, Sex und Poesie in der Schwulenbewegung
von Ulrike Heider
Gebunden, 256 Seiten, 18 €,
Männerschwarm Verlag