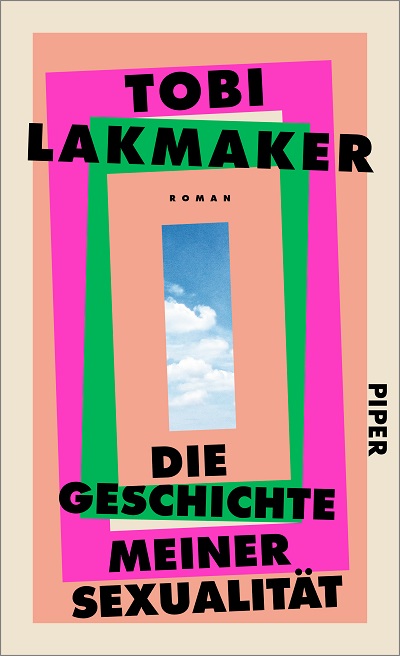Tobi Lakmaker: Die Geschichte meiner Sexualität
Buch
Mit 17 plant Sofie eine „solide Entjungferung“ mit Walter. Einige Jahre später hat sie es aufgegeben, die Frau zu werden, die andere in ihr sehen. Sie trägt die Haare raspelkurz, schwärmt für Jennifer, Muriel und Frida. Wie Sofie fast zum Star der lesbischen Community von Amsterdam wird, unter heftiger Verliebtheit leidet und doch darum ringt, andere nah an sich heranzulassen, erzählt Tobi Lakmaker in seinem Debütroman „Die Geschichte meiner Sexualität“. Er schreibt von den Räumen zwischen Weiblichkeit und Männlichkeit, von queerer, fluider und Trans-Identität – und von wahrer Intimität, die dort beginnt, wo wir alle Kategorien vergessen. Anja Kümmel über einen (Nicht-)Roman, der immer dann am besten ist, wenn er melancholische Risse in der ironischen Distanziertheit zulässt.
Memes, Haikus und Foundation
von Anja Kümmel
Die Jungs, die Sofie mit 17 abschleppt, geben beim ersten Date Sätze von sich wie „Ich mag keine selbstbewussten Frauen“, oder sie schwafeln endlos über ihre Erkenntnisse, wie Mädchen zu Frauen werden. Besonders sexy oder interessant findet Sofie das zwar nicht, aber einen Moment später knutschen sie dann doch. Schließlich hat Sofie Großes vor: Eine „solide Entjungferung“, sprich: eine, von der sie später ihren Kindern erzählen kann.
So werden wir in Tobi Lakmakers „Die Geschichte meiner Sexualität“ hineingeworfen – ein in den Niederlanden als literarische Sensation gefeierter Debütroman, der eigentlich kein Roman ist, sondern vielmehr eine Sammlung autobiografischer Kolumnen zum Thema Dating, Sex und Gender. Und Familie. Und Fußball.
Lakmaker wurde 1994 in Amsterdam geboren und hat sich letztes Jahr als trans Mann geoutet. Dass ein Buch, in dem es hauptsächlich um die Fluidität von Sexualität und Geschlecht und das Finden der eigenen Identität geht, eine derartige Aufmerksamkeit von den Mainstream-Medien bekommt („Das neue literarische Talent 2021“, jubelte etwa die Vogue) und nun in deutscher Übersetzung im Publikumsverlag Piper erscheint, ist tatsächlich eine kleine Sensation. Über die literarische Qualität des Texts sagt das allerdings recht wenig aus.

Tobi Lakmaker – Foto: Willemieke Kars
Lakmaker hat sich für einen dezidiert ungeschliffenen, direkten Erzählton (mit punktuell gesetzten poetischen Einschüben) entschieden, der auf den ersten Blick angenehm unverstellt rüberkommt. Da heißt es dann etwa: „Genau genommen, gibt es viele Dinge, die ich nicht so richtig verstehe, und da rede ich dann gerne ein bisschen drum herum.“ Sofort fühlt man sich dem Autor nahe, quasi mit ihm auf Augenhöhe. Die Anekdoten, die Lakmaker in kurzen Kapiteln erzählt, sind so simpel und so komplex wie das Leben selbst – in diesem Fall: das Coming-of-Age eines queeren Millennials der Amsterdamer Bohème. Erst datet das Erzähl-Ich eine Reihe ziemlich luschiger Typen, mit denen der Sex von unterirdisch zu erträglich variiert, später dann Mädchen, mit denen der Sex zwar besser ist, die für eine längere Beziehung jedoch auch nicht wirklich in Frage kommen. Entweder, sie wollen nur ein bisschen experimentieren und hauen mit dem nächstbesten Jazzpianisten ab, oder – wie die coole Kapitänin von Sofies Fußballmannschaft – sie verstehen Küssen bereits als zu große Intimität. Und wenn es dann doch mal ernst zu werden droht, ist Sofie diejenige, die sich aus dem Staub macht. Nebenbei erzählt Lakmaker auch von einem halbherzig begonnenen Philosophie- und Literaturwissenschaftsstudium, verschiedenen Aushilfsjobs, einem Camping-Trip durch Europa, vom Schreiben und vom Fußball. Und, immer wieder, vom Anecken der Erzählfigur an gesellschaftliche Vorstellungen von Weiblichkeit, einem wachsenden Unwohlsein im eigenen Körper, zugleich aber auch vom Staunen und Amüsement angesichts gängiger Männlichkeits-Rituale.
Diese Passagen, in denen Lakmaker die transparenten Folien der Heteronormativität mit leicht ironischer Distanz hervorhebt und dadurch überhaupt erst sichtbar macht, gehören zu den besten des Buches. Als etwa das Erzähl-Ich auf einer Party die hübsche Schauspielerin Jennifer kennenlernt, sagt diese im Gespräch über ihr Outfit: „Das sei keine Lesbenlatzhose. ,Ich bin einfach eine Lesbe in einer Latzhose. Das ist was anderes.‘“ Was in ihrer Einfachheit eine ziemlich treffende Bemerkung ist – und dazu noch verdammt charmant rüberkommt. Was folgt, ist nicht schwer zu erraten. Eine Weile lang schwebt Lakmakers Erzählfigur auf Wolke sieben. Im Kreis von Jennifers allzu perfekten Schauspiel-Kolleginnen fühlt sie sich allerdings zunehmend fehl am Platz. „Ab und zu schlug ich ein Bein übers andere, um auch Frau zu sein, wenigstens für kurze Zeit, aber dann sagte Jennifer immer: ,Du spielst das zu groß.‘“ Dass Gender vor allem Performance ist, merkt Lakmakers Alter Ego auch dann, wenn es männlich gelesen wird, wie etwa beim Bier bestellen in der Kneipe: „Männer gehen miteinander oft sehr kumpelhaft um. Ob fünfzehn oder vierunddreißig, du bist immer ihr Freund. Deswegen traute ich mich auch nie zu sagen, dass ich eine Frau bin: Dann ist man sofort einen ganzen Freundeskreis los. Und was für einen.“ So flapsig die Hauptperson auch daherreden mag, klingt immer wieder eine tiefe Melancholie des Nirgends-Dazugehörens durch, die ihrer ironischen Distanziertheit Risse zufügt.
Mehr davon hätte Lakmakers Nicht-Roman gutgetan! Denn so sehr sich der Text auch gegen das ihm aufgezwungene Label sperrt, so smooth fügt er sich dann doch wieder in bestimmte Erzählkonventionen – wenn auch vielmehr in die von Kolumnen oder Blogeinträgen. Diese folgen letztendlich einem simplen Rezept: Ein mehr oder weniger am Geschehen beteiligtes „Ich“ berichtet in konstant auf Gags gebürstetem Plauderton aus dem eigenen Leben. Zwei, drei Kapitel lang geht man da gerne mit. Durch ein ganzes Buch hindurch trägt dieser Erzählstil jedoch nicht. Der durchgängig humoristische Tonfall ermüdet irgendwann; und was man anfangs als angenehm authentisch empfand, wirkt nach einer Weile aufgesetzt und repetitiv. Auf Dauer sorgen die vielen Abschweifungen um der Situationskomik willen für ein richtungsloses Mäandern, das eher über einen hinweg plätschert als zu berühren. Da berichtet die Hauptfigur etwa von einem sexistischen Übergriff, und schreibt im nächsten Satz über niederländische Museumspolitik und Schokobrunnen. Oder sie erzählt in einem Atemzug davon, dass die Großmutter ihrer Mutter in Auschwitz vergast wurde und dass die Mutter ihr Fahrrad gelb streicht, damit es niemand klaut. Holocaust oder Fußball-WM, strukturelle Gewalt oder die richtige Farbe von Abdeckpuder, alles verhandelt Lakmaker im selben saloppen Plauderstil. Nach einer Weile stellt sich das Gefühl ein, durch eine Flut endloser Posts auf Facebook oder Instagram zu scrollen: Memes neben Haikus, Katzenvideos neben Aufrufen zur politischen Aktion – kuratiert einzig nach den undurchsichtigen Kriterien der Aufmerksamkeitsökonomie.
Dabei stechen durchaus geistreiche Sätze heraus, die ganz unprätentiös neue Einsichten bieten. Etwa diese: „Das Ärgerliche an Genialität ist nur, dass es sich damit genauso verhält wie mit Homosexualität: Man wird es nicht, man es ist.“ Oder: „Wenn man nie etwas tut, was man albern findet, geht auch nichts voran.“ Oder: „So ist das mit Menschen, die zu lange Ich sind: Sie werden nie mehr Du.“ Tatsächlich steckt „Die Geschichte meiner Sexualität“ voller Bonmots, die sich perfekt zum Tweeten und Re-Tweeten anbieten. Irgendwann jedoch hat man das Prinzip kapiert, und es beginnt zu langweilen. Hier mal eine prototypische Passage: „Das ist das Problem mit Sex: Wenn man einmal damit anfängt, findet man meist kein Ende. Zu Unrecht, wenn ihr mich fragt. Tatsächlich ist Sex so was wie eine Wasserleitung: Superärgerlich, wenn was nicht funktioniert, aber ohne geht es eben auch nicht. Das heißt natürlich nicht, dass sich das ganze Leben um Wasserleitungen dreht. Versteht ihr?“ Dann folgt eine Einordnung in den persönlichen Kontext, bevor das Kapitel mit einem philosophisch-tiefgründigen Satz endet. Für sich genommen gut und schön, aber zwei Handvoll Aperçus machen eben noch keinen gelungenen Roman. Anscheinend weiß Lakmaker das – warum sonst die Häufung direkter Ansprachen, die wohl dazu dienen sollen, die Leserschaft immer wieder auf kumpelhafte Weise abzuholen, wenn sie sich im Wust der Aphorismen zu verlieren droht? „Na, wenn du mich fragst“, „Ich schwör’s euch“ und „versteht ihr?“ gehören zu Lakmakers Favoriten – und sind doch auf Dauer so nervig und überflüssig wie Foundation, Mascara und Glätteisen, mit denen sich sein Alter Ego in der Pubertät herumplagt. Absurderweise schafft es dieses überstrapazierte Stilmittel an einigen Stellen sogar, an sich wirkungsvolle, poetische Sätze kaputtzumachen: „Es war schon wieder hell geworden, und das Leben atmete zahllose Möglichkeiten, wenn ihr mich fragt.“
Was man den Autor tatsächlich gerne fragen würde, ist, warum er sich so penetrant an seinen Leser:innen festkrallt und permanent um deren Zustimmung buhlt. Wobei auch hierzu eine Szene möglicherweise eine Erklärung liefert. Die Hauptperson sitzt in einem Literaturwissenschaftsseminar und ärgert sich über die Ansicht der Dozent:innen, „dass man den Text selbst betrachten und die Absicht des Autors außen vor lassen solle“. Lakmaker schreibt weiter: „Ihr könnt sicher sein, dass ich euch finden werde, wenn ihr meine Absichten außen vor lasst. Vielleicht bin ich ja der erste wirklich lebendige Autor. Sollte dieses Buch je in einem literaturwissenschaftlichen Seminar diskutiert werden – ruft mich kurz an. Dann schwinge ich mich aufs Rad und verrate euch, was meine Absichten waren.“ Das klingt nicht nur wie eine Drohung – Lakmaker hat sie bereits wahrgemacht. „Der erste wirklich lebendige Autor“ hat einen Großteil seines Debütromans totgeschrieben, indem er immer wieder um die Ecke biegt, um uns seine „Absichten“ zu erklären. Was wirklich schade ist, denn „Die Geschichte meiner Sexualität“ steckt voller interessanter Ansätze. Endlich mal ein Buch zu lesen, das eine Suchbewegung beschreibt, ohne an einem festgelegten Endpunkt anzukommen, das sexpositiv ist, aber auch das Unwohlsein der Hauptfigur mit Sex thematisiert, hätte eine echte Bereicherung für die queere Literatur sein können.
Dass man „den Autor“ nicht gleich für tot erklären muss, um uns Leser:innen einen Anteil an der Lakmaker so verhassten „Interpretation“ zu überlassen, bezeugen diverse herausragende Werke der queeren Autofiktion: Man denke etwa an Chris Kraus, Maggie Nelson, Paul B. Preciado oder Ocean Vuong. Die nächste Generation steht bereits in den Startlöchern – und hoffentlich werden uns nicht alle androhen, beim kleinsten eigenen Denkansatz persönlich mit dem Fahrrad vorbeizukommen.

Die Geschichte meiner Sexualität
von Tobi Lakmaker
Aus dem Niederländischen von Christina Brunnenkamp
Hardcover, 224 Seiten, € 20,00
Piper Verlag