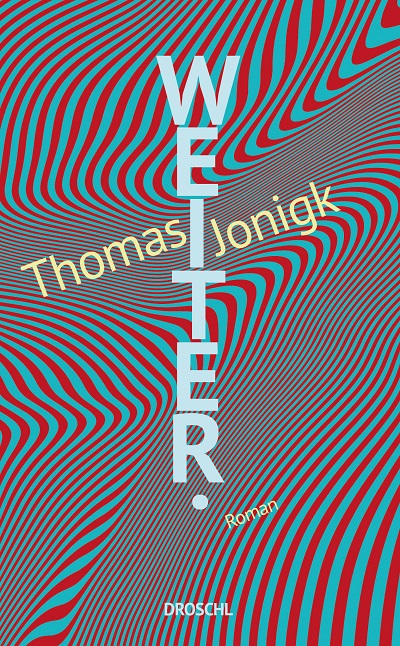Thomas Jonigk: Weiter.
Buch
Anfang des Jahres feierte Thomas Jonigks Bühnenfassung von Klaus Manns „Mephisto“ Premiere im Staatstheater Kassel. Jetzt ist Jonigks neuer Roman erschienen: „Weiter.“ steht in der Erzähltradition von Oscar Wilde, allerdings ohne dessen Schöngeist zu kultivieren. Im Gegenteil: Die Figuren des Romans sind total am Ende und versuchen deshalb, sich gegenseitig vor dem Schlimmsten zu bewahren. Was deprimierend klingt, entpuppt sich jedoch als faszinierendes Kammerspiel mit optimistischem Ausgang. Unser Autor Christian Lütjens ist beeindruckt.
Zeitalter der Impotenz
„Weiter.“ – Thomas Jonigk verwendet den Titel seines neuen Romans im Manuskript ganze 196 Mal. Ergibt im Schnitt einmal „Weiter“ pro Buchseite. Das ist eine Menge und es ist unweigerlich redundant, aber es ist natürlich so gewollt. Der Titelbegriff ist Stilmittel, Antreiber und Taktgeber einer Geschichte über zwei Menschen, die einander in einer Welt, die jeden Sinn verloren zu haben scheint, für ein paar wahrhaftige Stunden Kraft geben weiterzumachen. Der Erschaffung dieser Menschen wohnt man beim Lesen des Buches bei, wie wenn man einem Künstler beim Malen eines Gemäldes über die Schulter guckt. Danach folgt ein poetisch-eklektischer Tanz am Abgrund, der das Hamsterrad der menschlichen Existenz durch die Macht der Fantasie sprengt.
„Ausführlich zu schildern, was sich niemals ereignet hat, ist nicht nur die Aufgabe des Geschichtenschreibers, sondern auch das unveräußerliche Recht jedes wirklichen Kulturmenschen.“ Auf dieses Zitat von Oscar Wilde beruft sich Geschichtenschreiber Jonigk im Prolog von „Weiter.“, um den Leser*innen danach mitzuteilen: „Und genau das mache ich jetzt. In diesem Augenblick. An diesem Tisch, in diesem (abgesehen von einem apathischen ins Leere starrenden Kellner) ausgestorbenen Café imaginiere, erfinde ich einen Menschen.“
So entsteht Robert, ein schwuler Hungerhaken mit Bolero-Jacke und Karottenhose, der an einem wolkenverhangenen Frühlingsnachmittag in einem Café in Berlin-Schöneberg einer jungen Frau namens Veronika (staubblondes Haar, Metallgestellbrille, Herrenjacket mit enormen Schulterpolstern) begegnet, während im Hintergrund „Smalltown Boy“ von Bronski Beat läuft. Angesichts der zahllosen Verweise auf die Trends und Moden der 1980er Jahre ist sofort klar, in welcher Epoche sich das Ganze abspielt. Wann genau, scheint zunächst unwichtig, aber Jonigk erwähnt es trotzdem – wohlwissend, dass es für die spätere Entwicklung der Geschichte eine entscheidende Rolle spielt. Es ist Mai 1986, jener Monat, in dem die Menschheit infolge der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl nicht nur vor radioaktivem Regen, sondern auch vor dem großen Atomknall zitterte.

Thomas Jonigk – Foto: Thomas Aurin
Doch bevor das Wort „Tschernobyl“ im Text zum ersten Mal Erwähnung findet, verlagert sich der Fokus erst einmal von Robert zu Veronika. Deren traurige Biografie wird in einem knapp hundertseitigen Exkurs so plastisch und ausführlich rekonstruiert, dass man die Figur und ihr Milieu förmlich riecht, schmeckt, spürt, manchmal sogar selbst vom Strudel des alles durchdringenden Selbsthasses erfasst wird. Von der Mutter verachtet, vom Vater sexuell missbraucht, von Gleichaltrigen geschnitten, hat sich die graumäusige Veronika, die nie eine Frau sein wollte, in einer unsichtbaren Existenz am äußersten Rande der Gesellschaft eingerichtet. Als der verhasste Vater stirbt, besucht sie erst die Beerdigung und beschließt anschließend einen Schnitt zu machen. Sie marschiert zu Karstadt und kauft fünf Meter Sisalseil. Damit will sie sich erhängen. Später, zu Hause. Doch zuvor muss sie vor einem drohenden Wolkenbruch in jenes Schöneberger Café flüchten. Wo sie Hungerhaken Robert kennenlernt. Der gerade von seinem langjährigen Freund Florian (Opernsänger) für einen 18-jährigen Schönling sitzengelassen wurde und infolgedessen genauso unter Lebensmüdigkeit und Selbstekel leidet wie Veronika – der aber trotz seiner windschiefen Mickrigkeit eine gewisse Hoffnung ausstrahlt. Auf ein Ende der Unsichtbarkeit. Auf ein selbstbestimmtes Dasein. Auf eine Alternative zum Sisalseil. Dann kommt der radioaktive Regen.
Im Laufe der Geschichte wird klar, dass im Prolog gar nicht Geschichtenschreiber Jonigk spricht, sondern Veronika selbst. Sie ist es, die in einem ausgestorbenen Café sitzt und beschließt, diesen Robert, ihren Retter, zu erfinden. Das klingt jetzt nach Spoiler-Alarm, ist aber eine eher vorhersehbarere Pointe des flackernd collagierten Textes, in dem die Perspektiven des Autors, der Figuren und der metaphysischen Stimmen, die Zitate aus Märchen, der Bibel, dem Unterbewusstsein der Protagonisten oder das ständig wiederkehrende „Weiter“ einstreuen, sowieso ständig wechseln. Außerdem ist das Kunstvolle dieses Romans weniger seine Geschichte als die Exaktheit, mit der er Bilder, Charaktere, Entwicklungen und Stimmungen heraufbeschwört und ihnen Allgemeingültigkeit verleiht. Das beste Beispiel ist die beiläufig eingebundene, aber bis ins kleinste Detail stimmige Abbildung des Zeitgeistes der 1980er Jahre und dessen Spiegelung an der heutigen Gegenwart. Wenn Robert im letzten Drittel des Buches über die apokalyptische Atmosphäre des Jahres 1986 räsoniert und sich über den damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan als „Mischung aus Cowboy, Witzfigur, Selbstdarsteller, Amateur, Phrasendrescher, Kretin und Diktator“ ereifert, charakterisiert er dabei gleichzeitig Donald Trump. Wenn er über den Aufstieg der Republikaner als „Katastrophe, die im Gewand des Parlamentarismus den Parlamentarismus zerstören (…) werde“, nachdenkt, winkt aus der Zukunft die AfD. Die Eighties-Reizwörter „Waldsterben“, „saurer Regen“ und „Ozonlöcher“ lassen sich auf die heutige Formel „Klimakatastrophe“ eindampfen. Auch Aids kommt zur Sprache. Corona lässt grüßen. Dass Jonigk das neue Virus beim Schreiben des im Februar erschienenen Romans noch nicht auf dem Zettel gehabt haben dürfte, unterstreicht die quasi-prophetische Grundstimmung des Textes.
Vor allem aber ist da dieses lähmende Gefühl von Vergeblichkeit, das Robert mit der Formulierung „Wir leben in einem Zeitalter der Impotenz“ auf den Punkt bringt. Eigentlich will er damit zum Ausdruck bringen, dass der Mensch Sklave seiner eigenen körperlichen, sozialisatorischen und politischen Beschränktheit ist, also unfähig, die Gesellschaft in ihrer Gesamtheit zu verändern. Bezogen auf Robert und Veronika kann man die Impotenz aber durchaus wörtlich nehmen. Infolge andauernder Verletzungen, Misshandlungen und Zurückweisungen haben die beiden allem Sexuellen abgeschworen und sich in konsequenter Ablehnung des eigenen Körpers zu Neutren in einer Welt der binären Geschlechterordnung erklärt. Dass die daraus resultierende Auflösung von Weiblichkeit, Männlichkeit und sexueller Identität eine neue, herrschaftsfreie Form von erotischer Anziehung hervorbringen könnte, hat keiner der beiden erwartet. Doch genau das passiert nach ihrer Begegnung im Café. So ist „Weiter.“ im Kern die Geschichte einer (sexuellen) Befreiung.
Man kann das Buch gut und gerne als Kaleidoskop der Themen, Erzählformen und stilistischen Spielereien sehen, die Jonigks Werk seit Jahren prägen. Wie in seinem Debütroman „Jupiter“ spielen Verdrängung und Selbsthass als Folge sexueller Gewalterfahrungen eine Rolle, wie in „Liebesgeschichte“ sind die Grenzen zwischen Verstörung und Komik fließend, wie in „Melodram“ werden Geschlechternormen analysiert, verwischt und hintertrieben. Auch dass Jonigk Theatermann ist – er war lange Dramaturg am Schauspielhaus Zürich, hat zahlreiche Bühnenstücke, Libretti und Drehbücher geschrieben – merkt man dem Buch an. Man kann sich „Weiter.“ bestens als atemlose Bühnen-Collage vorstellen, in der zwei oder mehr Schauspieler*innen das Textkonvolut aus Einschüben, Klammern, Perspektivwechseln und stilistischen Kontradiktionen performen, indem sie ständig unterschiedliche Rollen und Haltungen einnehmen.
Ob Schöngeist Oscar Wilde „Weiter.“ gemocht hätte? Es ist fraglich. Die staubblonde Veronika könnte eher dem Imaginationskosmos von Charlotte Roche oder Heinz Strunk entstammen als dem Wilde’schen Kabinett adrett anbetungswürdiger Frauenzimmer. Und Robert ist zwar schwul, aber weit weg vom Ideal der schönen Jünglinge, wie Wilde sie bevorzugte. Eine ausführliche Schilderung dessen, was sich niemals ereignet hat, ist der neue Jonigk aber in jedem Fall. Ein forderndes, poetisches und auf subtilste Weise spannendes Buch ist er sowieso.
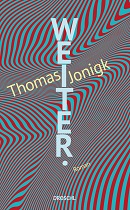
Weiter.
von Thomas Jonigk
Gebunden, 200 Seiten, 20 €,
Literaturverlag Droschl