James Baldwin: Giovannis Zimmer
Buch
Der US-Schriftsteller James Baldwin (1924-1987) ist nicht nur eine Ikone für die Bürgerrechtsbewegung, wovon jüngst etwa Raoul Pecks vielschichtiger Dokumentarfilm „I Am Not Your Negro“ Zeugnis trug, sondern auch für das Gay Liberation Movement. Anfang 2018 startete der Deutsche Taschenbuch Verlag (dtv) eine Werkausgabe in neuen Übersetzungen, in der nun einer der berühmtesten „schwulen Romane“ überhaupt erschienen ist: „Giovannis Zimmer“ aus dem Jahr 1956. Darin lernt der weiße Amerikaner David in Paris den Kellner Giovanni kennen, und die beiden erleben eine kurze, qualvolle amour fou in der klaustrophoben Enge von Giovannis Zimmer. Unser Autor Fabian Hischmann, Jahrgang 1983, schreibt über ein zeitloses Meisterwerk, das Leser*innen in seiner schonungslosen Beschreibung einer toxischen Beziehung noch heute bis ins Mark erschüttert.
Eine Höhle, in der ich gemartert würde
von Fabian Hischmann
Ende Februar wurde ich gefragt, ob ich „Giovannis Zimmer“ von James Baldwin lesen und es auf seine Relevanz für meine Generation abklopfen wolle. Ende Februar – das war noch eine ganz andere Zeit und kommt mir ewig vor. Abends traf ich mich mit Freunden in einer Bar. Damals durfte man sich noch umarmen.
Jedenfalls sagte ich die Besprechung zu. Allerdings ohne mir anzumaßen, für meine ganze Generation zu sprechen, weil das natürlich nicht geht. Weil am Ende, zum Glück, jede*r selbst für sich entscheidet.
Immer und überall wird der Name James Baldwin flankiert von Prädikaten wie „Genie“, „Legende“ oder „Ikone“. Es gibt einen grandiosen Dokumentarfilm von Raoul Peck („I Am Not Your Negro“), zahlreiche kluge Schriften (akut empfehlen kann ich das sehr gute Nachwort von Sasha Marianna Salzmann, das im Anhang des hier besprochenen Romans gleich mitgeliefert wird) und Hip-Hop-Mastermind Jay-Z zitiert Baldwin im epischen Video zu „Family Feud“. Feuilleton und Popkultur verehren den Mann in seltener Eintracht.

James Baldwin – Bild: ullstein bild / Roger Viollet / Jean-Pierre Couderc
Zu Beginn seiner Karriere war das nicht abzusehen. Da empfahl Baldwins Agentin ihm dringend, das Manuskript zu „Giovannis Zimmer“ zu verbrennen und fortan darüber zu schweigen. Um seiner selbst willen. Diese beschämende Reaktion spricht Bände und spiegelt die tief konservativen Überzeugungen, den Hass gegenüber Minderheiten, in den USA zu Zeiten der McCarthy-Ära wider. Dass Baldwin sich davon nicht beirren ließ, zeugt von großem Mut und einem unerschütterlichen Glauben an die eigenen literarischen Fähigkeiten, die Notwendigkeit, seine Geschichte zu erzählen. Zeitlebens wehrte Baldwin sich gegen die weiße Unterdrückung, sah den „moralischen Ungeheuern“ seines Landes ins Gesicht. Er wusste, dass es noch gefährlicher gewesen wäre, ihnen den Rücken zuzukehren.
Man kann sich als weiße, privilegierte Person kaum vorstellen, was People of Color, was Künstler*innen in einem ebenso kapitalistisch-weiß wie heteronormativ geprägten Kulturbetrieb wie dem der USA aushalten mussten und vielfach immer noch müssen. Der Kampf um Anerkennung und Gleichberechtigung ist längst nicht ausgefochten. Wenn 2020 ein schwarzer, schwuler Schriftsteller über einen sich selbst verleugnenden weißen US-Expat schreiben würde, wäre das für etliche Menschen auch heute noch ein Skandal. Was natürlich der eigentliche Skandal ist! Begriffe wie Abscheu und Bigotterie mögen anachronistisch klingen, sind aber immer noch Teil der Realität. Und auch in einer globalen Krisensituation wie jetzt, einer Situation, die alle Menschen betrifft, verschwindet Diskriminierung nicht. Im Gegenteil: Expert*innen zufolge haben Schwarze in den USA im Schnitt eine schlechtere Krankenversicherung und weniger Zugang zu medizinischer Versorgung. Auch Vorerkrankungen wie Diabetes und Herzkrankheiten treten demnach häufiger auf. Das erhöhe nach den bisherigen Erfahrungen das Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf und auch das Sterberisiko, berichtet etwa der Deutschlandfunk. Diese Zusammenhänge sind weder neu, noch auf eine Viruserkrankung wie Covid-19 begrenzt. Sie sind das traurige Resultat eines Jahrhunderte andauernden Rassismus.
Das Rezensionsexemplar kommt noch vor dem Kontaktverbot bei mir an. Als ich es aus dem Karton befreit habe, sehe ich ein Gesicht: Geschlossene Augen, ein Ausdruck zwischen Erleichterung und Trauer. Ich gehe zum Bücherregal. Meine erste Assoziation täuscht. Der junge Mann auf dem Cover von Hanya Yanagiharas „Ein wenig Leben“ und der junge Mann auf dem Cover von „Giovannis Zimmer“ unterscheiden sich dann doch sehr. Den großen Schmerz im Gesicht auf Yanagiharas Cover ahnt man schon vor dem Aufschlagen. Die Aufmachung der Baldwin-Neuausgabe ist viel weniger eindeutig. Aber schon im ersten Kapitel wird klar, dass es auch in diesem Buch um Schmerz geht, um die zermürbende Angst vor sich selbst:
„Mir dämmerte: Joey ist ein Junge. Auf einmal sah ich die Kraft in seinen Schenkeln, in seinen Armen und in seinen lose geballten Fäusten. Die Kraft, das Versprechen, das Geheimnis dieses Körpers machten mir Angst. Dieser Körper kam mir auf einmal vor wie die dunkle Öffnung zu einer Höhle, in der ich gemartert würde, bis der Wahnsinn eintrat, in der ich meine Männlichkeit verlieren würde.“
(S. 15)
Die Gedanken und Befürchtungen der noch jungen Hauptfigur David zu Beginn dieser Geschichte stehen Pate für viele schwule Coming-of-Age-Geschichten, die danach geschrieben wurden. Geschichten, in deren Mittelpunkt stets die Vermutung steht, die auch David gegenüber sich selbst hegt, bevor er in die Welt aufbricht: „Vielleicht wollte ich, wie wir in Amerika sagen, mich selbst finden.“ (S. 29) Seine Suche führt David ins Paris der 1950er Jahre. Doch auch hier, erfährt man sogleich, verharrt er in Abhängigkeiten und falschen Verbindlichkeiten:
„Mein Vater hatte auf seinem Konto Geld, das mir gehörte, aber er ließ sich immer lange bitten, weil er wollte, dass ich nach Hause komme – nach Hause, wie er sagte, um sesshaft zu werden, und wann immer er das sagte, dachte ich an den Bodensatz am Grund eines stehenden Gewässers. Damals kannte ich noch nicht so viele in Paris, und Hella war in Spanien.“ (S. 30)
Hella ist Davids Verlobte, sein Alibi für die Welt abseits der Pariser Nächte. Diese durchstreift er mit Jacques, seinem einsamen, älteren Gönner. In einer dieser Nächte begegnet David schließlich Giovanni, dem neuen Barkeeper im Etablissement des zwielichtigen Guillaume:
„Hochmütig, dunkel und löwenhaft, mit dem Ellbogen auf der Registrierkasse, mit den Fingern das Kinn umspielend, stand er da und betrachtete die Menge, als stünde er auf einer Landzunge und betrachtete uns, das Meer.“ (S. 36)
Am Ende ihrer ersten Begegnung findet David sich in Giovannis Zimmer wieder:
„Ich dachte, wenn ich nicht sofort die Tür aufmache und von hier verschwinde, bin ich verloren. Aber ich wusste, dass ich die Tür nicht aufmachen konnte, ich wusste, dass es zu spät war; bald war es zu spät, und ich konnte nur noch stöhnen. Er zog mich an sich, legte sich in meine Arme, als sollte ich ihn tragen, und zog mich langsam auf das Bett hinunter. Während jede Faser in mir Nein! schrie, seufzte doch alles zusammen Ja.“ (S. 76)
Was im zweiten Teil des Romans folgt, ist stellenweise schwer auszuhalten und ich kann mich nicht erinnern, wann ich Romanfiguren zuletzt so dringend schütteln und anschreien wollte. Hier wird einem eindrucksvoll vor Augen geführt, wie schonungslos und detailliert man über eine toxische Beziehung, über Liebeskummer schreiben kann. Mit aller Gewalt kämpft David gegen sein Schwulsein, sein Begehren an. Ob durch Sex mit einer flüchtigen weiblichen Bekanntschaft oder mit der aus Spanien zurückkehrenden Hella. Und zerstört dadurch sowohl Giovanni als auch sich selbst:
„‚Aber ich bin ein Mann‘, rief ich, ‚ein Mann! Was meinst du denn, kann zwischen uns passieren?‘
‚Du weißt genau was zwischen uns passieren kann. Deshalb verlässt du mich doch.‘ Er boxte mit der Faust auf die Fensterbank. ‚Wenn ich dich halten könnte, würde ich es tun‘, schrie er. ‚Und wenn ich dich schlagen müsste, anketten, aushungern – wenn ich dich halten könnte, ich würde es tun. […] Eines Tages wirst du dir vielleicht wünschen, ich hätte es getan.'“ (S. 163)
Viel ist über diesen Roman von James Baldwin schon geschrieben worden. Viel mehr müsste ich noch schreiben, um der Tragik und seiner Relevanz für die Gegenwart gerecht zu werden. Daniel Schreiber hat in seinem Blurb für die deutschsprachige Neuausgabe versucht, „Giovannis Zimmer“ in einem Satz zusammenzufassen: „Die wahrscheinlich tragischste Liebesgeschichte, die je geschrieben wurde.“ Zumindest ist sie ganz weit vorne dabei, würde ich sagen.
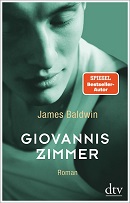
Giovannis Zimmer
von James Baldwin
Aus dem Englischen von Miriam Mandelkow
Mit einem Nachwort von Sasha Marianna Salzmann
Gebunden, 208 Seiten, 20 €,
dtv

