David Santos Donaldson: Grönland
Buch
Als „glänzender Debütroman“ und „stylischer Fiebertraum“ wurde David Santos Donaldsons „Greenland“ nach seinem Erscheinen im vergangenen Sommer von der US-Presse gefeiert. Tatsächlich verbindet die metafiktionale Geschichte über einen jungen Schriftsteller, der durch die Arbeit an einem Roman über E. M. Forster zu seinem eigenen, von postkolonialem Rassismus und internalisierter Homophobie gezeichneten Selbst vordringt, etwas Fantastisches. Jetzt ist der Roman in deutscher Übersetzung bei Albino erschienen. Sebastian Galyga hat ihn gelesen und ein Buch entdeckt, das trotz zahlreicher Zeit- und Erzählebenen fest in unserer Gegenwart verwurzelt ist – nicht zuletzt wegen seiner queeren Direktheit.
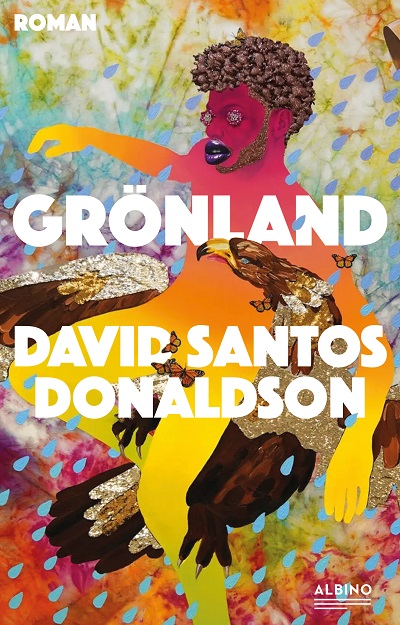
Gespenstische Nähe
von Sebastian Galyga
Eigentlich hat Kipling Starling, genannt Kip, seinen großen Debütroman längst geschrieben: ein ausführlich recherchiertes historisches Werk über die Liebesbeziehung zwischen dem britischen Schriftsteller und Fast-Nobelpreisträger E. M. Forster und dem ägyptischen Straßenbahnschaffner Mohammed El Adl. Leider ist kein Verlag interessiert, es regnet Absagen. Eine berühmte Lektorin versichert Kip, er habe Talent, aber auch sie werde sein Buch nicht veröffentlichen, es biete in der jetzigen Fassung nichts Neues. Verzweifelt fragt Kip, was er ändern müsse, damit sie ihre Meinung noch mal überdenkt. „Nun, vielleicht sollten Sie die Geschichte aus der Perspektive von Mohammed erzählen. Das wäre interessant!“
Die Prämisse von David Santos Donaldsons Debütroman ist erstmal wunderbar absurd: Kip bleiben nur drei Wochen, um ganz schnell einen neuen Roman zu schreiben. Doch Mohammed, die neue Hauptfigur dieses Blitzwerkes, gibt seine Geschichte nur nach und nach preis und zwingt Kip unweigerlich dazu, selbst Teil der Geschichte zu werden, die er doch eigentlich nur aufschreiben will. Die Handlung wächst sich immer weiter aus, fliegt von New York nach Europa, nach Ägypten, ins titelgebende Grönland und auch obendrein hundert Jahre in die Vergangenheit.
Die Struktur des Romans erscheint auf den ersten Blick bekannt. Eine Person der Gegenwart berichtet in einer Rahmenerzählung darüber, wie sie eine historische Geschichte, die den Hauptteil des Buches ausmacht, recherchiert und schreibt. Doch bei dem vorliegenden Roman entwickelt das Konzept ein Eigenleben: Zwar dient Kips Gegenwart auch hier als Hinleitung zum historischen Liebesdrama zwischen Forster und Mohammed, aber sie wächst im Laufe der Handlung immer weiter an, stülpt sich der historischen Haupthandlung über und löst diese am Schluss fast vollständig in sich auf. Konkret heißt das, dass die Vergangenheit von Kips Leben Besitz ergreift. Mohammed beginnt zu ihm zu sprechen und selber zu erzählen, die Grenzen zwischen Kips New Yorker Apartment und den Straßen Alexandrias vor hundert Jahren verschwimmen. Wer erzählt hier wessen Geschichte? Schreibt Kip wirklich über die Figur von damals? Oder ist er am Ende selbst nur eine Zukunftsvision des halluzinierenden Mohammed, die all die Freiheiten erleben kann, die jenem verwehrt bleiben?
„Ich schreibe diese Geschichte, weil ich will, dass du dich an mich erinnerst. Ich will, dass du weißt, dass du nur lebst, weil ich dich geträumt habe. Du – mein junger schwarzer Mann der Zukunft – musst wissen, dass ich es bin, der dich geträumt hat, einhundert Jahre vor diesem Tag. Hier im Jahr 1919, in meiner kalten Zelle in Mansourah um die Geisterstunde, träume ich von dir.“

David Santos Donaldson – Foto: privat
Neben dem komplexen Spiel mit Erzähl- und Zeitebenen, das für sich genommen schon sehr unterhaltsam ist und genug Stoff für einen Roman liefert, ist „Grönland“ auch eine kunstvolle Reflexion über Marginalisierung. Auf den ersten Blick könnten Kip und Mohammed nicht weiter voneinander entfernt sein, ihre Lebensrealitäten sind völlig konträr: der eine konnte an den besten Universitäten der Welt studieren, ferne Länder bereisen und sich selbst verwirklichen, der andere lebt in Armut am unteren Ende einer bedingungslos hierarchischen Klassengesellschaft. Und doch gibt es viele Parallelen, die die beiden einander geradezu gespenstisch nahebringen. Beide sind schwarz, beide sind schwul und haben einnehmende Liebesbeziehungen zu weißen Männern. Indem Donaldson die zwei Figuren zusammenführt und in manischen Visionen miteinander sprechen lässt, gelingt ihm ein hochgradig literarischer Dialog über Freundschaft und Liebe, aber auch über Rassismus und Homophobie in der Gesellschaft. Ohne ästhetische Kompromisse einzugehen, erzählt „Grönland“ gleichermaßen präzise und ergreifend von queeren Erfahrungen und strotzt vor Wahrhaftigkeit.
In Ankündigungen des Buches hieß es, Kips Auseinandersetzung mit der Vergangenheit werde zu einem „Proust’schen Portal in die eigene Erinnerungswelt“. Dem muss widersprochen werden, es ist irreführend. „Grönland“ hat weder stilistisch noch thematisch viel mit Proust zu tun. Donaldsons Sprache ist ganz ausdrücklich eine zeitgenössische. Zwar schließen ihre Wortgewandtheit und Poesie an die „große Literatur“ an, auf die sich der Roman immer wieder beruft, es werden aber auch Register von, sagen wir mal: Sex, Lust und Rotzigkeit gezogen, die „Grönland” eindeutig zu einem Buch der akuten Gegenwart machen. Dank der größtenteils überzeugenden Übersetzung von Joachim Bartholomae gelingt dieser Spagat auch im Deutschen.
„Ich entzog mich ihm und fragte mich, weshalb die Begierden der Männer immer Leid verursachen. Ich wollte eine schöne Freundschaft mit Morgan, aber nicht berührt werden.“
Sätze wie diese verdeutlichen, dass Donaldson weiter geht als Proust. Die Art, wie er die Grenzen zwischen Historie und Gegenwart einreißt, um (mit Leichtigkeit!) abstrakte Fragen nach der Interpretierbarkeit von Kunst und Geschichte zu stellen, erinnert eher an A. S. Byatts „Besessen“, während die Geisterstimmen und die literarische Auseinandersetzung mit Identität, Selbstermächtigung und Aneignung an Sharon Dodua Otoos „Adas Raum“ denken lassen. Große Bezugspunkte, die aber keinesfalls zu hoch gegriffen sind.
Die einzige Schwäche des Romans ist, dass er zuweilen ein bisschen zu sehr darum bemüht scheint, seine Botschaft auch ja verständlich zu machen. Manche bereits etablierte Motive und Ideen werden wiederholt, wenn nicht gar erklärt, bevor sie erneut in der Handlung anklingen. Das mag für unaufmerksame Lesende, die ein über 400 Seiten fassendes Buch wie dieses über mehrere Wochen oder Monate hinweg lesen und gern daran erinnert werden, worum es im Vorfeld ging, hilfreich sein, aber es ist eigentlich nicht nötig. Hier hätte der Autor mehr Vertrauen ins Publikum und seine eigene Erzählkunst haben können. Donaldsons zugängliche Sprache und die angenehm kurzen Kapitel mit gut gebauten Spannungsbögen schaffen einen solchen Sog, dass es leichtfällt, sich der Erzählung bereitwillig hinzugeben und das Buch gar an einem Stück zu lesen.
Aber gelegentliches Over-Explaining ändert nichts daran, dass „Grönland“ ein wahnsinnig guter Roman ist, der die großen, vielleicht etwas ausgelutschten Fragen, was Liebe und Kunst sind, neu denkt und umsichtig um die Themen Postkolonialismus, Rassismus und Queerness erweitert. Das Ergebnis: eine literarische Geisterbeschwörung, in der Vergangenheit und Gegenwart durcheinandergeraten und mit Göttern, Toten und Psychiatern gesprochen und geschlafen wird – ein famoser literarischer Ritt.

Grönland
von David Santos Donalson
aus dem Englischen von Joachim Bartholomae
Hardcover, 416 Seiten, € 28,
Albino Verlag
