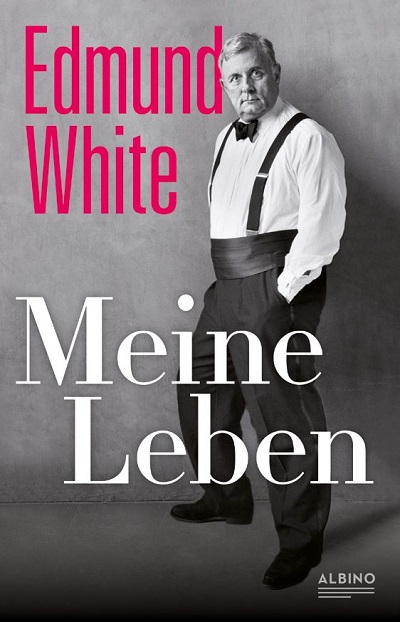Edmund White: Meine Leben
Buch
Mit den Erinnerungsbänden „City Boy“ und „Der Flaneur“ sowie mehreren vom eigenen Leben inspirierten Romanen wurde Schriftsteller Edmund White nicht nur zur Ikone der amerikanischen Schwulenliteratur, sondern auch zum Meister des autobiografischen Schreibens. Nun sind im Albino Verlag mit dem 500-Seiten-Wälzer „Meine Leben“ seine Memoiren in deutscher Übersetzung erschienen. Unser Autor Marko Martin witterte dahinter zunächst ein Stück Copy-and-Paste-Literatur, ließ sich am Ende aber von den detailsatten Beschreibungen und der Fabulierlust des ebenso hochgebildeten wie unprätentiösen Erzählers White mitreißen.
Porträt des Künstlers als gewitztes Früchtchen
von Marko Martin
Edmund White hat schon mehrere Bücher mit autobiografischen Texten veröffentlicht und war bereits Meister dieser Form des Schreibens, als es die Genre-Bezeichnungen Autofiktion und Memoir noch gar nicht gab. Der Gedanke liegt nahe, dass seine soeben in deutscher Übersetzung erschienene Autobiografie lediglich ein neuer Aufguss altbekannter Themen und Texte ist. Könnte das Buch statt „Meine Leben“ also auch den Titel „Meine Bücher“ tragen?
Doch gemach. Die Autobiografie des 1940 in Cincinnati/Ohio geborenen Romanciers ist alles andere als ein literarisches Copy-and-Paste-Produkt. Gleichwohl werden Fans und Bewunderer von Whites Erzähl-Elan hier manch Bekanntes wiederfinden – die Kindheit und frühe Jugend in einem ebenso bürgerlich-konventionellen wie absurd dysfunktionalen Elternhaus etwa; die Flucht ins wilde New York der siebziger Jahre; den Einbruch von Aids in den Achtzigern; seine Übersiedlung nach Paris und die Bekanntschaft mit dortigen Intellektuellen ebenso wie die nächtlichen Begegnungen an der Seine und in den Tuilerien. Umso faszinierender, wie es White gelingt, in diesem Grundgerüst seiner Existenz immer wieder Neues aufzuspüren, lange Jahre Unerinnertes, womöglich auch Verdrängtes.
Der libidinös zeitlebens sehr umtriebige Schriftsteller, der bereits 1989 das Testergebnis HIV-positiv erhielt – also lange vor der Zeit von Pillen-Cocktails und Therapien – ist einer der weltweit raren Fälle eines Überlebenden ohne Symptome. Viele seiner Freunde und Partner dagegen gingen elend zugrunde; auch ihrer Tode wird in „Meine Leben“ gedacht. Dennoch geht White mit dieser existentiellen Erfahrung eher diskret um; hochtrabende Confessio-Worte sind seine Sache nicht. Mitunter scheint der selbsternannte Atheist ein wenig allzu furchtsam das Gelübde seines Ordens einzuhalten: Nur keine Metaphysik und letzten Fragen, keine Zweifel und keine Sinngebungsreflexionen.

Edmund White – Foto: Michael Taubenheim
Ohnehin mäandert nichts in Edmund Whites kristalliner Prosa, und so ist auch „Meine Leben“ nach einem durchaus strengen, wenn auch ironisch gemilderten Ordnungsprinzip komponiert. Den Eingangskapiteln „Meine Seelenklempner“, „Mein Vater“, „Meine Mutter“ folgen konzise Erinnerungstexte etwa über „Meine Stricher“, „Meine Blonden“, „Meine Freunde“ oder „Mein Europa“. Auch „Mein Genet“ ist vertreten. White schrieb Anfang der neunziger Jahre eine umfangreiche Biografie über den französischen Schriftsteller, die bis heute als Standardwerk der Jean-Genet-Forschung gilt.
Dennoch geht es hier nicht um Nabelschau auf dem Podest – und trotz zahlreicher erhellender Miniaturporträts etwa über Susan Sontag oder Michel Foucault auch nicht um Namedropping. Vielmehr gelingt es White, mit wenigen Sätzen sogleich eine Gestimmtheit, eine Atmosphäre, ein Milieu zu zeichnen. Dabei kommt ein weiteres Plus dieses trotz seiner über fünfhundert Seiten eminent kurzweiligen Buchs zum Tragen: Der ebenso hochgebildete wie unprätentiöse, ja mutwillige Autor fällt sich immer wieder selbst ins Wort, um mögliche Klischees zu vermeiden und der Falle zu entgehen, sich im Nachhinein als allzu attraktiv-altruistisch zu stilisieren.
Und wie präzis er erzählt, auch von peinigenden Erfahrungen: vom ultra-konventionellen Midwest-Vater, der seinerzeit bereits das Tragen einer Armbanduhr für verweichlichend hielt, oder von der psychologisierenden Mutter, die den Knaben mit acht Jahren einem Rorschach-Test unterzog und ihm danach „schizophrene Tendenzen“ bescheinigte. Unterdessen nutzte das älter werdende Früchtchen das vom Vater erhaltene Taschengeld, um für zwanzig Dollar junge Provinzmänner in Karohemden und staubigen Stiefeln dafür zu bezahlen, nicht länger vor Greyhound-Busstationen herumzulungern, sondern mit ihm in eine Absteige zu gehen. „Ich war nicht hässlich, aber ich war minderjährig, und selbst für einen Teilzeithomosexuellen war das Leben in der Eisenhower-Ära nicht leicht.“ Man ahnt es, wird jedoch nie penetrant mit der Nase darauf gestoßen: Die scheinbare Leichtigkeit, mit der hier vom Bedrückenden solcher Erfahrungen erzählt wird, ist hart erarbeitet.
Im New York der siebziger Jahre findet der junge Edmund White dann endlich mit Charles Silverstein einen versierten „Seelenklempner“, der ihm nicht nur keine neuen Komplexe einredet, sondern die Welt weitet. „Charles und ich beendeten die Therapie, als ich den Auftrag bekam, das Buch ‚Die Freuden der Schwulen‘ zu schreiben, mit – Achtung, Überraschung – Dr. Silverstein als Co-Autor.“
Generell scheint White von den Emanzipationsbewegungen jener Zeit profitiert zu haben, ohne dabei zum Aktivisten oder gar Ideologen geworden zu sein. Wahrscheinlich würde er es auf diese Weise formulieren: Lieber 69 als ’68er. Auch sein mit der Zeit wachsender literarischer Ruhm wird eher en passant erwähnt; fast scheint es, als hätte sich White als bestes Erbe des zentrumsfernen Mittleren Westens eine gewisse joviale Hemdsärmeligkeit bewahrt, eine Distanz gegenüber Posen. Mit Sicherheit nicht unkritisch gegenüber dem American Way of Life, versagt sich der Autor auch jenes larmoyante Lamentieren, dem noch für jedes erlebte Missgeschick sogleich die verantwortliche Adresse einfällt: die Gesellschaft, das System. Und anstatt, wie inzwischen allzu häufig Usus, in der eigenen Community zänkisch nach realen oder auch nur herbeiphantasierten „Ausgrenzungsmustern“ zu fahnden oder auf eigenen, vermeintlich nicht genug geschätzten Meriten zu bestehen, zitiert er ganz lapidar einen seiner Literaturprof-Kollegen aus Princeton: „Wenn ich doch noch einmal sechzig wäre. Das war ein gutes Alter. Du wirst schon sehen, in den Siebzigern fällt alles auseinander.“
Ansonsten dreht sich Whites Schreiben schwerpunktmäßig und immer wieder um Sex, um Quickies oder längere Affären, die er im Laufe der Jahre und Jahrzehnte durchlebte. Redundant wird dies deshalb nicht, weil er sich darauf versteht, seine wechselnden Partner stets markant zu charakterisieren. Richtig lustig wird es, wenn er seine (späten) Erfahrungen mit Sadomasochismus beschreibt und sich in fortgeschrittenem Alter sogar auf einer Website registriert, die den Namen slaves4masters.com trägt. Ganz eindeutig: der wirkliche Lustgewinn besteht hier in der detailsatten, doch stets ironisch-distanzierten Beschreibung der darauffolgenden Begegnungen.
Im Januar 2021 ist Edmund White in seiner Wahlheimatstadt New York 81 geworden; im Jahr zuvor war ein neuer Roman erschienen, die Geschichte zweier unkonventioneller Zwillingsschwestern. Wer erfahren will, dass Würde und Empathie keineswegs immer auf hochmoralischen Stelzen daherkommen müssen, sondern sich mitunter als Fabulierlust camouflieren, lese seine hochspannende Autobiografie.

Meine Leben
von Edmund White
Aus dem Amerikanischen von Joachim Bartholomae
Gebunden, 520 Seiten, 28,00 €
Albino Verlag